Eike Barmeyer (Hrsg.): Science Fiction

Eike Barmeyer (Hrsg.): Science Fiction. Theorie und Geschichte. Uni-Taschenbücher, Band 132. Wilhelm Fink Verlag München 1972. – Science-Fiction-Sachbuch. Mit einer Auswahlbibliografie zur Literatur über Science-Fiction und einem Namen- und Titelregister. Taschenbuch, 388 Seiten.
Der literaturwissenschaftliche Essayband Science Fiction erschien 1972, nur wenige Jahre nach den Studenten- und Jugendprotesten von 1968, und ist demgemäß erheblich von den politischen Grabenkämpfen beeinflusst, die der Umbruch von 1968 in Gang gebracht hatte. Als Uni-Taschenbuch hat der Band im deutschsprachigen Raum eine starke Verbreitung gefunden und stellt bis heute ein viel zitiertes Referenzwerk dar. Heute wirken die enthaltenen Beiträge zum Teil stark angestaubt, aber eine Reihe von ihnen sind immer noch anregend zu lesen, trotz des häufig sperrigen Jargons, der nach akademischer Geltung heischt, und trotz manch aufgeblasener, ätzender Polemik, die sich nur an ihrer eigenen Geschliffenheit ergötzt.
Die Studenten- und Jugendproteste von 1968 brachten eine ungeheure Eruption utopischen Denkens hervor. Die Kritik von 1968 am überall verspürten restaurativen „Muff“, an zementierten autoritären Strukturen und an der bis dahin mangelnden Aufarbeitung des Dritten Reichs gewann eine kompromisslose Schärfe und gesellschaftsverändernde Kraft. In ihrer Folge wurde mit ernsthaftem Eifer nach Alternativen zum kapitalistischen System gesucht, wobei zuallermeist auf den Marxismus mit seiner Idee der klassenlosen Gesellschaft zugegriffen wurde. Die jungen Leute kämpften für die Verwirklichung einer freieren und gerechter gestalteten Gesellschaft im Hier und Jetzt – durch Protestkundgebungen, in Kommunen oder in der Durchsetzung der universitären Mitspracherechte der Studentenschaft.
Es ist gewiss kein Zufall, dass zu derselben Zeit, als an den Universitäten der utopische Aufbruch erprobt wurde, auch die Science-Fiction erstmals als ernstzunehmendes Forschungsobjekt ins Blickfeld der Literatur- und Sozialwissenschaften rückte – als der zeitgemäße literarische Ausdruck utopischen Denkens par excellence. Der hier besprochene Band steht am Beginn dieser Entwicklung in Deutschland und stellt eine der ersten deutschsprachigen Essaysammlungen zum Thema dar. Dass die Autoren damals noch aufgrund fehlender Vorarbeiten zu einem erheblichen Teil „fannische“ oder von Science-Fiction-Autoren verfasste diskursive Literatur sowie die Literatur benachbarter Felder (z. B. Studien zu den utopischen Romanen oder zur trivialen Massenliteratur) heranziehen mussten, liegt auf der Hand. Einige Autoren sind selbst Science-Fiction-Schriftsteller, so vor allem Stanislaw Lem, der mit Abstand bedeutendste Autor des Bandes, oder zählen wie Franz Rottensteiner zum Kreis von Aficionados, Kritikern und Herausgebern.
Zählt man die umfangreiche Einleitung des Herausgebers hinzu, enthält der Band 21 Essays und Artikel, nebst einer von Franz Rottensteiner verfassten Auswahlbibliografie zur Literatur über Science-Fiction. Neun der Beiträge waren zuvor bereits in Monografien oder Zeitschriften erschienen (vgl. S. 374). Gleich drei Beiträge sind von oder beschäftigen sich mit Stanislaw Lem, einer behandelt Olaf Stapledon. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Utopiebegriff, denn gleich zwei Beiträge beschäftigen sich mit den literarischen Utopien und aufklärerischen Staatsromanen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, während ein dritter Beitrag versucht, den Begriff des utopischen Denkens näher zu fassen. Die übrigen Essays behandeln eine Reihe disparater Aspekte, zum Beispiel die – existente? – Poetik der Science-Fiction, die Aufgaben der Science-Fiction in einer technisierten Welt, die Tiefenpsychologie der Science-Fiction, die Science-Fiction in Russland, die New Wave oder die ideologischen Grundlagen der deutschen Science-Fiction-Heftromane.
1. Eike Barmeyer: Einleitung
In seiner Einleitung kommt Eike Barmeyer auf die problematische Vielfalt an Definitionsversuchen zum Begriff Science-Fiction zu sprechen. Er selbst definiert die Science-Fiction als „Literatur der prognostischen Phantasie im technischen Zeitalter“ (S. 7), gibt aber darüber hinaus auch Hinweise auf die vielen Kriterien, die in den Begriffsbestimmungen schon ein- oder ausgeschlossen wurden. Eine Bestimmung von Vera Graaf aus ihrem Buch Homo Futurus. Eine Analyse der modernen Science Fiction (1971) etwa bezeichnet das Genre als „eine spekulative Prosaform, in der mit wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Mitteln dem zum gegenwärtigen Zeitpunkt Unmöglichen entweder in einem Angst- oder in einem Wunschbild der Schein des Möglichen gegeben wird“ (Homo Futurus, S. 173; zitiert bei Barmeyer S. 10). Auf den sense of wonder als ein grundlegender und überaus wichtiger Reiz des Genres mag Barmeyer im Science-Fiction-Begriff freilich nicht verzichten. So verweist er unter anderem auf Iwan Jefremows Wort von der „Entrückung in andere Welten, in die schöne Welt der Zukunft“, die „etwas Magisches“ habe (S. 10), und erkennt in der extrem radikal formulierten marxistischen Science-Fiction-Kritik von Hans Joachim Alpers und Ronald M. Hahn eine pathologische Haßliebe zum Genre, die sich nicht offen eingesteht, dass die Science-Fiction jenseits der Rationalität eben doch auch eine Faszination ausübt, die die freie, neugierige Fantasie anspricht (vgl. S. 16 f.).

Barmeyer mahnt mit Blick auf eine zukünftige Bestimmung der Science-Fiction und ihrer Definition die „befreiende Kraft wissenschaftlichen Denkens“ an, die „auch auf einer tieferen psychischen Ebene erfahrbar“ gemacht werden sollte (vgl. S. 14). Hier werden Wünsche formuliert: Der Autor bedauert den Zustand der Science-Fiction und pocht auf Besserung. Das geht so weit, dass er vorgreifend eine „idealtypisch zu entwerfende widerspruchsfreie Definition“ des Genres begrüßen würde – ein Programm –, dem dann „in Zukunft eine zu kritischem Selbstbewusstsein gelangte, theoretisch fundierte und literarisch zulängliche Science Fiction“ folgen könnte (S. 20). Statt das Genre so zu nehmen, zu analysieren und zu definieren, wie es sich tatsächlich präsentiert, formuliert Barmeyer Forderungen, was Science-Fiction idealiter und per definitionem sein sollte. Das war schon damals en vogue und ist es bis heute in der theoretischen Literatur über das Genre geblieben – zumindest in Deutschland. Wissenschaftlich im engeren Sinne war diese Haltung dem Genre gegenüber nie.
2. Werner Krauss: Geist und Widergeist der Utopien
Werner Krauss (1900–1976), bis 1964 Professor für Romanistik an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin und überzeugter Anhänger des Sozialismus, bietet in seinem Beitrag einen sehr interessanten Überblick über die abendländische utopische Literatur seit dem Mittelalter – von Cocagne, dem französischen Schlaraffenland des 12. Jahrhunderts, über Campanellas „Sonnenstaat“ (1602), Thomas Morus’ Utopia (1516), Cervantes’ Don Quichote (1605/15) bis hin zu den aufklärerischen utopischen Romanen wie etwa Sébastien Merciers Das Jahr 2440 (1771). Krauss beobachtet räumliche und zeitliche Utopien – Utopia wurde entweder auf einer einsamen Insel bzw. in einem abgeschlossenen Tal oder aber in der Zukunft verortet. Das Denken in die Zukunft aber, so Krauss, ist letzten Endes das eigentliche Signum des Utopischen. Im Gegensatz dazu vermochten ältere, rückwärtsgewandte Fantasien eines Goldenen Zeitalters kaum utopische Impulse auszulösen, die auf eine Infragestellung der bestehenden Verhältnisse hätten zielen können. Das auf eine veränderbare Zukunft gerichtete utopische Denken hat erst im Zuge des Fortschrittsgedankens der Aufklärung, durch den die prinzipielle Veränderbarkeit der Zukunft durch den Menschen überhaupt erst ins Bewusstsein trat, an Gewicht gewonnen.
Bemerkenswert sind die subversiven Ideen der vorindustriellen Utopien. Radikal wurde alles in Frage gestellt, was das zeitgenössische Leben konstituierte: Religion, staatliche und wirtschaftliche Organisation, familiäre Zwänge. Bereits im 17. Jahrhundert entstand die kollektivistische Idee einer Gesellschaft ohne Privateigentum, die durchgängig bis in den Marxismus des 19. Jahrhunderts hinein die grundsätzliche Antwort auf die drückenden Probleme der despotischen Herrschaft und der ungerechten Verteilung von Besitz und Gütern lieferte. Krauss benennt einen elementaren Unterschied der Science-Fiction zur Utopie im vorindustriellen Zeitalter: Waren früher technische Fortschritte innerhalb einer utopischen Erzählung nur staunenswertes Beiwerk, während das Hauptaugenmerk auf den utopischen Entwurf einer harmonischen Gesellschaftsordnung lag, wird in den zeitgenössischen „technokratischen Romanutopien“ der Fortschritt der Technik „auf dem unverändert übernommenen Fundament der kapitalistischen Wirtschaftsordnung“ inszeniert (S. 45f.) – eine Diagnose, die zweifellos bis heute gültig geblieben ist. Mehr noch: Der Kapitalismus triuphiert in der Science-Fiction von heute stärker denn je. Die Autoren sehen seine negativen Konsequenzen mit großer Klarheit, aber die Hoffnung auf Besserung haben sie aufgegeben. Ihre zukünftigen Gesellschaften sind oft mörderische Potenzierungen der kapitalistischen Gegenwart – düster und rau. Utopische Versuche, über unser fatalistisch festgefahrenes Weltbild, globalisiert und „alternativlos“, hinauszukommen, sind allenthalben rar.
Krauss sieht dagegen aus anderen, freilich romantisch anmutenden Gründen ein Versiegen der utopischen Literatur kommen. In seiner Erwartung, dass der Sozialismus zu seiner Vollendung gelangen wird, „wir jedoch über den Sozialismus nicht hinausdenken“, wird die Utopie „ihre eigentliche Dimension“ verlieren, und: „Die Utopie kann uns nicht mehr tiefer zu Herzen gehen“ (S. 46). Bislang ist die Geschichte bekanntlich anders verlaufen. Aus heutiger Perspektive nötigt Krauss’ Erwartung zu der Frage: Hat der Sozialismus als utopische Antwort ausgedient? Und wenn ja: Ist tatsächlich kein Hinausdenken über den Sozialismus als utopische Antwort möglich? Das zu klären, wäre vielleicht eine spannende – oder frustrierende – Aufgabe einer neuen, ernsthaft um gesellschaftliche Prozesse bemühten utopischen Literatur.
3. Hans-Jürgen Krysmanski: Die Eigenart des utopischen Romans
Der Soziologe Krysmanski bemüht sich in seinem Beitrag – ursprünglich die Einleitung seiner Monografie Die utopische Methode (1963) –, „den utopischen Roman als die Erscheinungsform einer instrumentalisierten Denkform zu begreifen“ (S. 48). Unter dem literarischen Gewand des utopischen Romans versteckt sich ein theoretischer Konstruktionsprozess. Als schöpferisches Instrument der Theoriebildung und Spekulation wie gleichzeitig als deren fiktionale Erprobung und Vergegenwärtigung vermag der utopische Roman – womit ausdrücklich auch der utopische Roman des 20. Jahrhunderts gemeint ist –, das soziale Hier und Jetzt zu befragen. Über viele umständliche argumentative Zwischenstufen gelangt Krysmanski zu seiner Definition des utopischen Romans: Er ist „die literarische Erscheinungsform der spielerischen Zusammenschau von Mensch, Gesellschaft und Geschichte in einem variablen, bildhaften Denkmodell von raum-zeitlicher Autonomie, das die Erkundung von Möglichkeiten losgelöst von der sozialen Wirklichkeit, jedoch mit Bezug auf sie, erlaubt“ (S. 54f.). Diese Möglichkeiten sind zunächst wertneutral und müssen nicht per se einem Wünschen oder Fürchten des Autors entsprechen; wichtig an der Erscheinungsform der instrumentalisierten Denkform ist vielmehr die Erkundungsbewegung, die dann erst auf die außerliterarische Realität bezogen werden kann.
Es mag sich jeder Leser selbst fragen, für wie praktikabel er die oben zitierte Definition Krysmanskis erachtet. Bei genauerem Hinsehen erscheint sie banal und daher Krysmanskis Beitrag wenig ergiebig.
4. Martin Schwonke: Naturwissenschaft und Technik im utopischen Denken der Neuzeit
Zu Beginn seines Essays führt der Soziologe Martin Schwonke zunächst seinen von Raymond Ruyer übernommenen Begriff des Utopischen aus, der sehr weit gefasst und fast umgangssprachlich wirkt: Utopien sind schlicht „Gedankenexperimente über andere Möglichkeiten“ (S. 58). Diese sind nicht nur auf politische oder gesellschaftliche Fragen bezogen, sondern können prinzipiell jede Frage in den Blick nehmen, also auch beispielsweise in der Technik oder der Medizin. Allerdings muss die utopische Idee prinzipiell möglich scheinen, also eine grundlegende Glaubwürdigkeit aufweisen – sie darf sich nicht vollständig von der realen Erfahrung unserer physischen Welt ablösen, wie es beispielsweise das Märchen oder die Fantasy tut.
Schwonke stellt im Folgenden fest, dass das forschende, entdeckende Tun der Wissenschaften – eine vorstellende, vorgreifende Bewegung ins Unbekannte, das dann erfasst werden soll – und das utopische Denken zumindest in ihrem ursprünglichen Impetus identisch sind. Eine wichtige Beobachtung ist, dass die Wissenschaften mit ihren Forschungsreisen seit dem 16. Jahrhundert das Aufblühen der abendländischen literarischen Utopien erst befördert haben. Die Utopien folgten also der Wissenschaft in ihrem Kielwasser, nicht umgekehrt. Mit dem technischen Fortschritt im 19. Jahrhundert kamen die fortschrittsoptimistischen Utopien jener Zeit auf; gleichzeitig entstanden aber auch „Gegenutopien“, wie Schwonke sie nennt, in denen sich die Angst vor dem Fortschritt ausdrückte und die Wissenschaft und die Technik dämonisiert wurden. Im 20. Jahrhundert schließlich habe, so Schwonke, das utopische Denken die selbstkritische Skepsis erlernt, und zu erwarten wäre jetzt „die große Zeit der naturwissenschaftlich-technischen Utopie“ (S. 65) – der Science-Fiction.
Für diese erstellt Schwonke einen Katalog von fünf Kriterien, die gehobene Science-Fiction kennzeichnen (sollen); zusammenfassend bezeichnet er sie so:
Utopische Darstellungen, die man heute „Science Fiction“ nennt, [ . . . ] sind nicht mehr naiv fortschrittsgläubig, sondern skeptisch gegenüber der Zukunft; sie schildern keinen optimalen Endzustand, kein Ende der Geschichte; sie fragen nach der Zulänglichkeit des Menschen; sie stellen das anthropozentrische Weltbild in Frage; sie gehen über vertraute Kategorien und Bezugssysteme hinaus. (S. 75)

Vor allem die Frage nach der „Zulänglichkeit des Menschen“ in der technisierten Welt ist für Schwonke in der zeitgenössischen Science-Fiction zentral, und damit hat er zweifellos recht. Das altertümliche Motiv des Roboters, das Schwonke heranzieht (S. 69ff.) und an dem er aufzeigt, wie mit ihm diese Frage reflektiert wurde – der Roboter zunächst als Sinnbild des menschenfeindlichen Fortschritts, später als eine mögliche Besserung der Unzulänglichkeit des Menschen –, ist in der heutigen Science-Fiction indes nicht mehr wirklich von Bedeutung. Eher ist es der Cyborg, also die Extension und Optimierung des Menschen durch Technik. Worauf es indes beim Roboter ankommt, ist, dass in dem Roboter eine künstliche Intelligenz steckt. Die KI ist dann das signifikante Thema, nicht mehr aber der Roboter selbst.
5. Michel Butor: Die Krise der Science Fiction
Krise? Welche Krise? Angesichts des auch schon damals großen kommerziellen Erfolgs des Genres kann der französische Schriftsteller Michel Butor (geb. 1926), selbst kein Autor von Science-Fiction, nur ästhetische Mängel meinen, und so stellt es sich dann auch heraus. Diese Mängel sind allerdings auch von Butors Bestimmung der Science-Fiction bedingt. Science-Fiction, so Butor, will die Wirklichkeit „über ihre Grenzen ausdehnen“, ohne sich von ihr zu trennen; das Imaginäre soll in das Reale, das durch die moderne Wissenschaft beschrieben ist, eingebettet werden. Er definiert das Genre als „eine Literatur, die das Feld des Möglichen erkundet, den Einblicken entsprechend, die uns die Wissenschaft gönnt“ (S. 76f.).
Das ist recht eng gefasst und scheint all die Erzählungen auszuschließen, die nur oberflächlich so tun, als seien ihre fantastischen Gebilde wissenschaftlich erklärbar, zum Beispiel in der Space Fantasy bzw. Space Opera. Erwartungsgemäß gerät die Space Fantasy denn auch bei Butor in die Kritik. In der völlig frei imaginierenden Space Fantasy, in der alles möglich ist, mangelt es der Fantasie an „Koordination“ (S. 79), und „das Resultat wird in nichts anderem bestehen als einem dürftigen Duplikat der Alltagswirklichkeit“ – ein seltsames, aus der Luft gegriffenes Verdikt, das offenbar auch eine mangelnde Kenntnis des Genres vermuten lässt. Bemerkenswerterweise lobt Butor auf der anderen Seite die enorme Assimilationsfähigkeit des Genres, einen Zug, den Stanislaw Lem (siehe sein Essay unten) am liebsten aus dem Genre ausschließen will. „Alle Arten von politischen und moralischen Fabeln, von Märchen und Mythen“, so Butor, vermag die Science-Fiction „in die Vorstellungswelt des modernen Lesers zu übertragen und ihr anzugleichen“ (S. 80); die Science-Fiction verkörpere „die Mythologie unserer Zeit in gemäßer Form“ (S. 82).
Worin aber ist nun der kritische Zustand des Genres zu sehen? Butor meint, er läge im ungezügelten Wachstum der Science-Fiction: Indem die Autoren eine schier überwältigende Masse unterschiedlicher Welten kreiert haben, die allesamt nicht miteinander koordiniert sind, würde das Genre seit geraumer Zeit in unverbindlicher Beliebigkeit feststecken. Die Schrankenlosigkeit des Träumens und der Fantasie in der Science-Fiction, die gewiss nicht wenige Autoren und Leser als besondere Qualität des Genres begreifen, ist für Butor ein Mangel. An ihre Stelle setzt er einen wahrlich bizarren Vorschlag (S. 84 f.): Die Science-Fiction müsste, um die „Gläubigkeit“ des Publikums zurückzugewinnen, vereinheitlicht und zu einer kollektiven Leistung werden. Autoren könnten, so Butor, gemeinschaftlich an einem einzigen, miteinander verabredeten Utopia schaffen und bauen – eine einzige, immer weiter ausgefeilte Science-Fiction-Welt der Zukunft, in der alle Werke der vielen unterschiedlichen Autoren spielen würden, die dann gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen müssten, um die Konsistenz des Ganzen nicht zu verletzen. Butor schwebt damit eine Art fest gefügter und detailliert ausgefeilter Mythos der Zukunft vor. Es ist fast überflüssig zu erläutern, wie inhaltlich beschränkt und funktional unzulänglich diese Idee ist. Ein derartiger Mythos, der mit Blick auf die Zukunft genauso ungeheiligt und unverbindlich wäre wie die Pluralität der durch ihn ersetzten Science-Fiction-Welten, wäre nicht in der Lage, die Fantasie des Menschen einzuhegen. Ein abwegiger Vorschlag.
6. Darko Suvin: Zur Poetik des literarischen Genres der Science Fiction
Der ab 1968 an der McGill-Universität in Montreal wirkende, aus Zagreb stammende Literaturwissenschaftler Darko Suvin (geb. 1934) beschäftigte sich in Sechziger- und Siebzigerjahren intensiv mit der theoretischen Beschreibung des Science-Fiction-Genres. Erste Studien dazu hatte er bereits 1965 in seinem Buch Od Lukijana do Lunjika in Zagreb veröffentlicht. Sein Hauptwerk zum Thema erschien später unter dem Titel Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre (1979), das in Deutschland vom Suhrkamp-Verlag als Poetik der Science Fiction: Zur Theorie und Geschichte einer literarischen Gattung (1979) herausgebracht wurde.
Suvins Definition der Science-Fiction, die er in seinem Hauptwerk historisch umrissen und theoretisch erläutert hat, findet sich schon hier: Er nennt sie in einer halbwegs griffigen Formel „Literatur der erkenntnisbezogenen Verfremdung“ (S. 86) und, etwas umständlicher:
Die SF ist [ . . . ] ein literarisches Genre, dessen notwendige und hinreichende Bedingung das Vorhandensein und das Ineinanderwirken von Verfremdung und Erkenntnis sind und deren formales Hauptstilmittel ein imaginativer Rahmen ist, der als Alternative zur empirischen Umwelt des Autors fungiert (S. 90).
Suvin grenzt diesen Begriff gegen den Mythos und das Märchen ab – und folgerichtig auch gegen die mythisch-märchenhafte Welt der Space Opera, in der keine vom Möglichen ausgehende Verfremdung mehr stattfindet, sondern einfach alles möglich ist:
Deshalb verübt eine SF, die sich ins Märchen zurückverwandelt (das heißt „Space Opera“ mit einem Dreieck, bestehend aus Helden, Prinzessin und Ungeheuer im Kostüm der Astronautik) in seinen schöpferischen Möglichkeiten Selbstmord (S. 90).
Denn die Science-Fiction ist meta-empirisch, aber nicht meta-physisch: Die Ethik etwa hängt nicht wie im Märchen oder Mythos von der Physik ab, in der sich eine höhere, eventuell göttliche Fügung anzeigte. Nichts in den physikalischen Gesetzen garantiert den Erfolg oder das Scheitern ihrer Helden, die aus sich selbst heraus agieren müssen, und es gibt auch keine pathetischen Natursymbole – in der Science-Fiction regnet es nicht, wenn der Held traurig ist (vgl. S. 93 f.). Es sollte klar sein, dass Suvin hier im Sinne der idealen Beschreibung seines Genrebegriffs zu apodiktisch wird, denn eine derartige Lupenreine wird man in der Science-Fiction – wenn überhaupt irgendwo in der Literatur – wohl eher selten antreffen.

Suvin holt literarhistorisch sehr weit aus, geht auf der Suche nach den Anfängen des Genres bis in die antike Mythen- und Sagenwelt zurück, überblickt die gesamte abendländische utopische Literatur und landet schließlich bei Verne und Wells. Der utopische Impetus, dessen Staffette durch die Geschichte er verfolgt, ist für Suvin die wesentliche Triebfeder, die das Genre im ausgehenden 19. Jahrhundert so beeindruckend explodieren ließ, und mithin ein unverzichtbares Kennzeichen des Genres, das er von „oben“, von seinen literarisch höchsten und bestgelungenen Werken aus zu definieren sucht:
So ist es nicht allein die zutiefst menschliche und vermenschlichende Neugierde, welche die SF gebiert. Neben einer ziellosen Begier zu forschen, einem semantischen Spiel ohne klaren Bezug, hat das Genre immer der Hoffnung angehangen, im Unbekannten die ideale Umwelt, den idealen Stamm, den idealen Staat, die höhere Intelligenz oder andere Aspekte des Höchsten Gutes zu finden – oder Furcht und Abscheu vor dem Gegenteil bezeugt. Jedenfalls wird die Möglichkeit anderer seltsamer, kovarianter Koordinatensysteme und semantischer Felder angenommen (S. 88).
So usurpiert Suvin das gesamte Feld der utopischen und fantastischen Literatur der abendländischen Literaturgeschichte und meint, ausgehend von der Bestimmung ihrer funktionalen Gemeinsamkeiten über alle historischen Bedingtheiten und formalen wie inhaltlichen Unterschiede hinweg, sie rückblickend und „neu interpretiert“ (S. 102) als Science-Fiction bezeichnen zu dürfen – wofür er freilich den modernen Begriff der science, die methodisch operiert, auf den allgemeineren Sinn der „Suche nach Erkenntnis“ ausweiten muss. Er untermauert das, indem er von direkten Entwicklungslinien zwischen den wichtigsten Schriftstellern ausgeht, die „sehr wohl um ihre zusammenhängende Überlieferung wußten“ (S. 100), Linien, die freilich von anderen Theoretikern des Genres oft abgelehnt werden: „Die Linie Lukian – More – Rabelais – Cyrano – Swift – Verne – Wells ist ein Hauptbeispiel“ (S. 100).
Wohin nun aber mit der zuvor so geschmähten Space Opera? Einen Platz für sie findet Suvin in der von ihm beschriebenen zweipoligen Struktur des Genres. Er spricht vom „extrapolierenden Modell“, nach dem die Science-Fiction die Gegenwart erweitert und utopische Welten kreiert, die an diese angebunden sind; und daneben vom „indirekten Modell“, nach dem die Science-Fiction mit analogen, nicht verifizierbaren Gegen- oder Anderswelten operiert, die nur in sich schlüssig sind. In diesem Feld gibt es wiederum große Extreme: Am einen Ende der Skala stehen die primitiven Analogien der Space Opera, die angeblich nach den Vorbildern vergangener Entwicklungsstufen wie etwa primitiven Stammesgesellschaften modelliert sind und als „bedrückend niedrig“ diffamiert werden, da sie ein nur „geringes Erkenntnisniveau“ entfalten, und am anderen Ende die höchst anspruchsvollen, ontologischen Analogien der Parabeln eines Stanislaw Lem.
Suvins Vorschlag der Universalisierung des Genres ist, soweit ich sehe, die Literaturwissenschaft mehrheitlich nicht gefolgt. Sie sieht die Genese des Science-Fiction-Genres erst mit Flammarion, Verne, Wells und Laßwitz einsetzen, während alle früheren utopischen Werke und Formen zwar die Grundlagen bildeten, diese sich aber, historisch bedingt, formal und inhaltlich doch zu stark von der späteren Science-Fiction unterscheiden und auch zu vereinzelt bleiben, um ein geschlossenes, über Jahrtausende hinweg fassbares Genre darzustellen, das dann auch noch mit dem heute gängigen Namen des Genres bezeichnet werden könnte. Zuguterletzt sei angemerkt, dass eine „Poetik“ im engeren Sinne, die die formalen Bauprinzipien des literarischen Textes der Science-Fiction idealtypisch analysiert, von Suvin leider nicht geboten wird. Insofern ist der Titel seines Essays ein Stück weit Etikettenschwindel.
7. Herbert W. Franke: Literatur in der technischen Welt
Herbert Werner Franke (geb. 1927) zählt zu den ganz wenigen deutschsprachigen Autoren, die gehobene, anspruchsvolle Science-Fiction geschrieben haben – intelligent und nachdenkenswert. Seine theoretischen Überlegungen zum Genre sollten daher einiges Gewicht haben. Sein Essay zielt indes wie die meisten anderen des Sammelbandes auf die Erörterung der Frage, wie sich das Niveau des Genres insgesamt heben ließe:
Die bereits vorliegende Science Fiction läßt sich nicht mehr verbessern, ihre Mängel lassen sich nicht hinwegdiskutieren. Aber was zu verlangen wäre, ist eine Näherung an das idealisierte Ziel: Science Fiction, intensiv im Ausdruck, überzeugend in der Darstellung, originell in der Idee und im Dienst einer Thematik, die es verdient, durchdacht zu werden. Trotzdem könnte die jeweilige Geschichte spannend bleiben, emotional wirksam, ein größeres Publikum ansprechend, sofern das im deutschen Raum mit Hochliteratur möglich ist. Sollte das nicht der Fall sein, so wäre es wünschenswerter, auf den Kunstanspruch zu verzichten als auf den Anspruch der Breitenwirkung – umso mehr als wir in einer Zeit leben, in der sich der Künstler seiner gesellschaftlichen Rolle bewußt zu werden beginnt. (S. 115f.)
Nun ließe sich wohl entgegnen, dass alle hier geäußerten literarpraktischen Forderungen von verschiedenen, wenn auch selten begegnenden Science-Fiction-Werken längst eingelöst wurden, auch damals schon – und man könnte, ohne schmeicheln zu wollen, Frankes eigene Werke ruhig hinzuzählen. Doch die Begriffe der „Hochliteratur“, des „Kunstanspruchs“ und der „Breitenwirkung“ zeigen an, dass es offenbar um mehr gehen soll, nämlich darum, im Feuilleton und in der öffentlichen Diskussion ernst genommen zu werden. Die Science-Fiction soll etwas zu sagen haben, sie soll mitreden, und sie soll endlich Zutritt zu den hehren Hallen der schönen Künste erhalten. Es wirkt wie das etwas frustrierte Streben des Parvenüs nach einem Adelstitel, der allein ihm die Brust zum Stolze schwellen könnte.
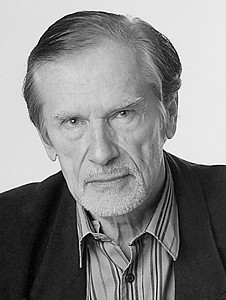
Die Science-Fiction, so stellt Franke fest, ist kein gewöhnliches Genre unter anderen Genres wie etwa der Western, der Kriminalroman oder die Fantasy; sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich mit den unmittelbaren und zukünftigen Auswirkungen der Technik auf den Menschen und die Gesellschaft beschäftigt und damit als einziges Genre auf den rasanten Fortschritt bezogen ist, der unsere Zeit prägt wie nichts sonst. Da Schriftsteller jedoch in der Regel geisteswissenschaftlich-humanistisch und nicht naturwissenschaftlich-technisch gebildet sind, geht ihnen das Verständnis und auch das Interesse für technische Themen ab, und hierin sieht Franke einen Grund, weshalb sich ästhetisch gut geschulte Schriftsteller nicht der Science-Fiction zuwenden und umgekehrt die Science-Fiction, verfasst von naturwissenschaftlich-technisch gebildeten Autoren, unter ästhetischen Defiziten zu leiden hat. Franke, der davon überzeugt ist, dass die von den Technologien verursachten Probleme wie beispielsweise die Umweltverschmutzung nur durch intelligentere, bessere Technologien lösbar sind, fordert daher Änderungen im Bildungssystem, und prangert eine vermeintlich überkommene humanistische Bildung „im Sinn der klassischen griechischen Ideale“ an, die die jungen Leute „zu technischen Analphabeten“ macht (S. 109). Franke gelangt hier allerdings unversehens zu prekären Forderungen. Er beklagt, dass die technisch analphabetischen „Humanisten“ die Schaltstellen der Politik besetzen (vgl. S. 108 f.), redet damit jedoch einer bedenklichen Technokratie das Wort, deren humanistisches Analphabetentum allenthalben bedrohlicher zu sein scheint.
Auch ist Frankes Einschätzung falsch, nach der die Philosophie den wissenschaftlichen Fortschritt nicht gebührend aufgegriffen und reflektiert habe (vgl. S. 109). Gerade die Philosophie hat genau das seit jeher immer schon getan und vermochte dann auch immer entscheidende Schritte vorwärts zu kommen. Sie vollzog die Aufgabe des helio- und anthropozentrischen Weltbilds ebenso mit wie die Relativierung des Menschentums durch Charles Darwin und die Relativierung von Raum, Zeit und Masse durch Albert Einstein und Werner Heisenberg. Auch heute verschließt sie sich keineswegs den aktuellen Fragestellungen der Genetik, der digitalen Vernetzung oder der künstlichen Intelligenz. Zuguterletzt ist Frankes erträumte Usurpation der ästhetischen Wissenschaften durch die Naturwissenschaften (genauer: durch die Informatik) höchst fragwürdig, zumal sie verbunden ist mit einem bösen Seitenhieb gegen die Hermeneutik, der er en passant die Urteilsfähigkeit abspricht:
Es entspricht der Geisteshaltung des Naturwissenschaftlers, daß er sich nicht mit a-priori-Einsichten zufriedengibt, nicht mit den Werturteilen der Hermeneutik, sondern daß er sehr reale Ansprüche stellt. Er will wissen, ob Kunst in unserer modernen Welt Sinn hat oder nicht, er will ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft kennenlernen, fragt nach ihrem Ursprung, den er in den Räumen der Ethologie und der Psychologie vermutet. (S. 112)
Das klingt gut in den Ohren von technikbegeisterten Autoren, die nur das glauben, was sich in Zahlen und mathematischen Formeln ausdrücken lässt, und die sich auf ihr althergebrachtes Feindbild, den irrealen Unsinn schwafelnden „humanistischen“ Literaturkritiker, eingeschossen haben. Die Idee: Die Überführung der Hermeneutik in eine „exakte Kunsttheorie“, die auf dem festen Grund der Informatik errichtet ist (Ähnliches wird sich auch weiter unten im Essay von Stanislaw Lem finden). Verwirklicht hat sich dieses Gespinst bisher nicht – allen jüngeren Fortschritten in der Vermessung abendländischer Schönheitsideale mittels Computern zum Trotz, die allerdings noch recht isoliert dastehen und in ihrer einseitigen biologischen Interpretation strittig bleiben –, und Franke müsste, wollte er daran festhalten, auch erklären, dass eine „exakte“, quantifizierbare Kunsttheorie auch ein anderes Menschenbild voraussetzte: Der Mensch reduzierte sich in ihr unweigerlich zu einem ebenso exakt quantifizierbaren Apparat, zu einem Kunst genießenden Computer. Dass es längst Scharen von geschäftlich höchst erfolgreichen Nerds im Silicon Valley gibt, die den Menschen genau so sehen, steht auf einem anderen Blatt, macht die hier aufgeworfene Frage jedoch nicht obsolet. Im Gegenteil.
8. James Blish: Nachruf auf die Prophetie
Der Science-Fiction-Autor und -Kritiker James Blish (1921–1975) räumt in seinem Beitrag mit dem altbekannten Fehlurteil der ältesten Garde der Science-Fiction-Fans auf, dass das geliebte Genre seine Daseinsberechtigung in handfesten Voraussagen für die Zukunft habe, etwa der Art: „Die Science-Fiction hat die Raumfahrt vorausgesagt“. Abgesehen von diesem und anderen bemerkenswerten Einzelfällen – etwa Heinleins Prophezeiung der Notwendigkeit, aus Sicherheitsgründen aus der zivilen Nutzung der Atomenergie auszusteigen, in seiner Story „Blow-Ups Happens“ (vgl. S. 121) – zeigt Blish auf, wie oft und wie gründlich sich die Science-Fiction mit ihren Prophezeiungen und mehr noch mit dem, was sie nicht prophezeit hat, in Hinblick auf die zukünftige Entwicklung verschätzt hat. Interessanterweise betont er dabei, wie wenig technologisches Wissen und Verständnis die meisten Science-Fiction-Autoren tatsächlich haben – gegen die Behauptungen von Herbert W. Franke –, dass umgekehrt aber auch Science-Fiction schreibende Wissenschaftler oft miserable Propheten sind, sich in ihren fiktionalen Werken gern nur eine Auszeit gönnen und dann erholsamerweise den Boden „harter“ Wissenschaftlichkeit verlassen.
Interessant ist Blishs Blick auf die zukünftige Entwicklung, und da erweisen sich einige seiner Prophezeiungen als eingetroffen. So behauptet er, dass die Wissenschaftler, die sich früher sehr oft von der Science-Fiction inspirieren ließen, zukünftig kaum noch Inspirationen von ihr empfangen werden. Zum einen würde das Genre immer mystischer und technikfeindlicher werden – so beispielsweise in Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum (1968) –, zum anderen würde eine neue Generation von Wissenschaftlern inzwischen selbst immer öfter zum Fantasieren neigen, in wissenschaftlichen Spekulationen, die in Fachzeitschriften erscheinen. Das aber sei etwas, das ihnen keiner ihrer Fachgenossen noch wenige Jahre zuvor hätte durchgehen lassen (vgl. S. 124 f.).
9. Jewgeni Brandis und Wladimir Dmitrijewski: Im Reich der Fantastik
Auch die beiden russischen Autoren Jewgeni Brandis (1916–1985) und Wladimir Dmitrijewski (1908–1978) eröffnen ihren kurzen Beitrag mit einem „Nachruf auf die Prophetie“ und lehnen eine prognostische Funktion der Science-Fiction ab. Das Verhältnis des Genres zur Wissenschaft ist ihnen dennoch unabdingbar, womit sie eine entschiedene Gegenposition zu Darko Suvins universeller Definition des Genres einnehmen:
Ist etwa das Verhältnis des Schriftstellers zur Wissenschaft nicht bestimmend für die Besonderheiten der heutigen utopischen Literatur und ihren Unterschied von der Literatur früherer Jahre? Lassen sich denn die Mythen und Märchen mit den Erzählungen Asimovs und Bradburys, die Romane Rabelais’ und die Novellen Hoffmanns mit den Büchern Jefremows und der Strugazkis vergleichen? Wenn wir das Wort „Phantastik“ beibehalten, das Wort „wissenschaftlich“ aber weglassen, so vermengen wir die Schirftsteller aller Zeiten, die ganze utopische Weltliteratur vom grauen Altertum bis zu unseren Tagen miteinander und verlieren die Möglichkeiten, zwischen den verschiedenen Arten und verschiedenen Typen der Phantastik einen Unterschied zu machen (S. 131).
Am Ende wird dem Sozialistischen Realismus der russischen utopischen Literatur das Wort geredet. Brandis und Dmitrijewski leugnen, dass die kommunistische Zukunft in den Werken der sowjetischen Science-Fiction-Autoren je als „rosige Idylle“ dargestellt worden sei, da auch in ihnen Konflikte geschildert werden, die die Helden, die nach immer größeren Leistungen streben, zu bewältigen haben. Tatsächlich ist Jefremows Andromedanebel (1958) nur ein leuchtendes Gegenbeispiel unter vielen gegen diese Behauptungen. Die annähernde Perfektion des kommunistischen utopischen Menschen bedingt, dass alle Widerstände bei der immer totaleren Unterwerfung der Natur letztlich gelöst werden – ein Scheitern ist ihm ideologisch per se untersagt.
10. Jürgen vom Scheidt: Descensus ad inferos – Tiefenpsychologische Aspekte der Science Fiction
Jürgen vom Scheidt (geb. 1940), damals Doktorand der Psychologie und auch selbst angehender Science-Fiction-Autor, bietet in seinem Essay einen interessanten Abriss über Sigmund Freuds und C. G. Jungs tiefenpsychologische Aussagen zur fantastischen Literatur. Bekanntlich hatten sich beide Gründerväter der Psychoanalyse schon sehr früh auch der fantastischen Literatur zugewandt und Klassiker des Genres wie etwa Rider Haggards Roman She (1887) analysiert. Vom Scheidt deutet, ihren Ergebnissen folgend, die Science-Fiction-Literatur als tiefenpsychologisches Phänomen – ein in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Genre seit Langem populäres Verfahren, das nicht selten dazu gedient hat, das Genre als Panoptikum unbewusster, literarisch nur schwach strukturierter Wahnbilder abzuqualifizieren. Diskriminierende Tendenzen sind auch in vom Scheidts Essay auszumachen. Science-Fiction ist demnach eine Ausdrucksform der unbewussten Regression, das heißt des Zurücksinkens in „frühkindliche Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensweisen“ (S. 134). Während Freud das „persönliche Unbewusste“ sichtbar zu machen trachtete, nahm C. G. Jung das „kollektive Unbewusste“ in den Blick und postulierte verschiedene mythologische „Archetypen“. Vom Scheidt unterschreibt beide Ansätze: Sowohl die persönlichen Regressionen als auch die Archetypen manifestieren sich seines Erachtens in der Science-Fiction.

Was aber viel wichtiger ist: Die Psychoanalyse ist davon überzeugt, diese Manifestationen – in distinktive Erzähl- und Bildmotive übersetzt – mit wissenschaftlicher Sicherheit identifizieren und auf bestimmte psychische Spannungszustände beziehen zu können. Gerade die Verifizierbarkeit und Belastbarkeit dieser psychoanalytischen Urteile aber erscheint mir regelmäßig höchst fragwürdig, ganz zu schweigen von einer Reihe von grundsätzlichen Problemen wie beispielsweise Sigmund Freuds zwanghafte Fixierung auf sexuelle und aggressive Triebe. So mögen die Zuordnungen, die die Psychoanalytiker und auch vom Scheidt in seinem Essay vornehmen, hier und da plausibel erscheinen – insbesondere Freuds Wort von „infantilen Allmachtsfantasien“ scheint tatsächlich sehr häufig auf die Science-Fiction zuzutreffen –, doch oft wirken sie auch willkürlich, den einzelnen psychotherapeutischen Probanden angepasst und letzten Endes nicht überprüfbar.
Vom Scheidt wird sich damals bei seinen Lesern vermutlich nicht viele Freunde mit seiner generellen Pathologisierung des Science-Fiction-Fans gemacht haben. Anhand des ausführlich diskutierten Fallbeispiels des 26-jährigen Science-Fiction-Fans T. D., der sich wegen psychischer Probleme in Behandlung begeben hat, will vom Scheidt den Nachweis führen, dass alle Science-Fiction-Fans an Regressionen leiden, die sie nicht zu überwinden vermögen. Er vergleicht sie mehrfach mit Drogenabhängigen und hält sie der tiefenpsychologischen Reifung und Befreiung von frühkindlichen Traumata bedürftig. Jawohl, Nerds sind oft unreif, das muss wohl eingeräumt werden. Aber nicht alle Science-Fiction-Fans sind Nerds. Oder unreife Nerds. Und nicht jeder unbewiesenen psychoanalytischen Behauptung muss blind über den Weg getraut werden.
Ähnlich ambivalent ist vom Scheidts Fazit über die Science-Fiction-Literatur, die er, von wenigen reflektierteren Ausnahmen abgesehen, als „unbewusste Form“ begreift (S. 156). Es ist zweifellos eine wichtige Beobachtung, dass in den meisten Science-Fiction-Romanen die Helden keine psychische Struktur und Entwicklung erfahren. Doch was antwortet die Psychoanalyse darauf?
Zusammenfassend ließe sich sagen, daß die SF-Geschichten deutlich eine (meist sehr tief gehende) Regression in frühkindliche, aber auch menschheitsgeschichtlich frühe psychische Muster behandeln, die mit technischer Symbolik lediglich kaschiert wird. Ergebnis solcher Regressionen ist ein Stillstand der psychischen Reifung, wie er sich am stärksten im weitgehenden Fehlen einer Beschreibung der psychischen Struktur der Handlungsträger der SF wie dem Ausbleiben ihrer psychischen Reifung kundtut. (S. 154)
Science-Fiction ist, sofern man hier noch folgen will, salopp formuliert sozusagen die anale Phase der gereifteren, höheren Literatur. Zum Schluss wird eine Besserung der Qualität der Gattung angemahnt, die sich stärker auf die menschliche Psyche konzentrieren möge, um schließlich dem Leser „zu größerer Menschlichkeit im seelisch-geistigen und sozialen Sinn“ zu verhelfen (S. 160) – was immer man sich darunter vorstellen soll.
11. Stanislaw Lem: Roboter in der Science Fiction
Dieser in Franz Rottensteiners Quarber Merkur (7. Jg., Nr. 3, November 1969) erstveröffentlichte Essay kann als ein Klassiker der Science-Fiction-Essayistik gelten; er ist im vorliegenden Sammelband zweifellos auch der ergiebigste. Lem hat sich bekanntlich sehr intensiv mit der theoretischen Beschreibung und Fundierung der fantastischen Literatur beschäftigt; nur zwei Jahre vor diesem Sammelband erschien dazu Lems zweibändiges Werk Fantastyka i Futurologia (1970; deutsch Phantastik und Futurologie, 1977). Wenig gefällt zwar die süffisante Herablassung, mit der Lem hier über das, was die Science-Fiction bisher über Roboter hervorgebracht hat, zu Gericht sitzt. Wohin Lem auch kopfschüttelnd blickt, findet er nur infantilen, oberflächlichen Mist. „Als maschinenhafte Gegenstände sind die Roboter in der Science Fiction falsch und als psychologische Individuen sind sie platt dargestellt“ (S. 172). Lems Abrechnung ist schonungslos und fährt über eine ganze Reihe von Erzählungen namhafter Science-Fiction-Autoren mit vernichtender Kritik hinweg. Abgesehen von der immerwährenden Klage über das „mitleiderregende Dasein“ der Science-Fiction (S. 185), die dem Leser auch in allen anderen Beiträgen des Sammelbands bis zum Erbrechen eingetrichtert wird, bietet Lems Essay einen höchst anregenden, streckenweise allerdings auch veralteten Diskussionsbeitrag zur Behandlung der Science-Fiction-Thematik von Robotern.
Von Robotern? Genauer wäre hier der jüngere Begriff der Künstlichen Intelligenz einzusetzen, denn darum geht es eigentlich: um künstlich geschaffene Maschinen oder Apparate, die wie Menschen bzw. Menschen ebenbürtig oder überlegen sind, und zwar in geistiger und psychologischer Hinsicht. Zunächst ist es für das Thema notwendig, mit der altertümlichen Vorstellung aufzuräumen, der Roboter/die Künstliche Intelligenz könne oder dürfe als Menschenwerk nichts weiter als ein schlichtes, kontrollierbares Werkzeug sein. Es ist ein Genuss zu lesen, wie Lem mit einfacher, bestechender Logik die Unsinnigkeit der berühmten Asimovschen Robotergesetze nachweist (S. 170 f.). Diese ließen sich nämlich niemals in ein wirklich autonom denkendes, intelligentes Wesen einprogrammieren:
Denn intelligent sein heißt soviel wie: seine eigene bisherige Programmierung durch bewußte Willensakte, dem aufgestellten Ziele entsprechend, abändern zu können. Somit kann zwar ein „Roboter“ für alle Ewigkeit für den Menschen vollkommen ungefährlich bleiben, aber dann muß er auch gewissermaßen dumm sein. Soll er aber intelligent, auf eigene Faust handeln können, muß er die Möglichkeit haben, sein eigenes Programm beliebig abzuändern. [ . . . ] Außerdem, und jetzt besprechen wir ein ganz anderes Problem, kann man einem anderen unabsichtlich Böses zufügen. Es passiert ja, daß ein Kind ein Tier dadurch umbringt, daß es ihm (unwissentlich) eine giftige Substanz zu fressen gibt: das Böse wird also unintentional zugefügt. Unter den Bedingungen des wirklichen Lebens handeln wir, indem wir Entscheidungen treffen, ohne über die Resultate unserer Handlungen völlig informiert zu sein. Sollte ein Konstrukteur dem Roboter „sehr starke“ Sicherungen einbauen, damit er niemandem Böses zufügen kann, würde er sehr oft völlig paralysiert erscheinen. Würde er z. B. zusehen, wie mehrere Menschen zugleich ertrinken, könnte er höchstwahrscheinlich keinem einzigen zu Hilfe kommen, weil er sich bewußt wäre, daß dadurch, wie auch immer seine Entscheidung ausfiele, die Chancen der anderen Ertrinkenden, gerettet zu werden, vermindert würden. Ein solcher Roboter würde nicht als besonders gelungene Konstruktion geschätzt. (S. 170 f.)
Haben die Autoren von Alex Proyas’ Film I, Robot (2004) Stanislaw Lem gelesen? Im Film, der das gleichnamige Buch Isaac Asimovs adaptiert, kommt exakt die hier ausgemalte Situation vor, in der ein den Asimovschen Gesetzen unterworfener Roboter in das Dilemma gerät, zwischen zwei Ertrinkenden eine Person zu wählen, um sie zu retten. Kurioserweise erleidet nicht der Roboter, sondern die gerettete Person – der Held des Films, Spooner (Will Smith) – anschließend ein seelisches Trauma, was zur Folge hat, dass Spooner den Roboter misstraut. Das Versagen der Asimovschen Gesetze wurde auch schon in einem viel früheren Film demonstriert, nämlich in Fred M. Wilcox’ Alarm im Weltall (1956). Der Roboter dort, Robby, gehorcht ebenfalls den Asimovschen Gesetzen. Als er das bedrohlich herannahende Id-Monster aufhalten soll, verfällt er jedoch in Paralyse, denn er erkennt, dass das Monster ein Teil der Persönlichkeit seines Herrn, des Wissenschaftlers Morbius, darstellt. Robbys Schaltkreise beginnen in der ausweglosen Konfliktsituation, in die ihn die Asimovschen Gesetze manövriert haben, zu überladen und vor Überspannung bedrohlich zu knistern, und der Roboter bleibt wie angewurzelt stehen. Indem Robby gar nicht handelt, ist er freilich dem Schutz der Menschen in Morbius’ Haus auch nicht dienlich – sein Dilemma ist nicht aufzulösen –, und nur Morbius’ Selbstaufopferung rettet am Ende die Situation.

Die scheinbare ethische Problematik, die Künstliche Intelligenzen aufwerfen würden und die in Science-Fiction-Visionen nach wie vor ein gewisses Unbehagen auslöst, ist im Prinzip gar keine, wie Lem völlig zu Recht feststellt: „Ein Wesen, das psychisch dem Menschen ebenbürtig ist, ist im ethischen Sinne ein Mensch“ (S. 179). So einfach ist das, zumindest in Hinblick auf das Gros der anthropomorphen Roboter und Künstlichen Intelligenzen in der Science-Fiction, deren Vernunft und psychologisches Verhalten dem Menschen eins zu eins nachgebildet ist. Robby, der Roboter, wäre demnach in ethischer Hinsicht ein Mensch und verdiente, menschenwürdig behandelt zu werden. Allerdings stellt sich schon auch die Frage, ob nicht problematische Zwischenstufen in der Entwicklung von Künstlichen Intelligenzen denkbar wären, bei denen die Feststellung des „Menschseins“ und der „Menschenwürde“ strittig bliebe. Auch lassen sich Künstliche Intelligenzen denken, die zwar intelligent und vernunftbegabt sind, denen ansonsten jedoch wesentliche Elemente menschlicher Ethik wie beispielsweise Barmherzigkeit und Mitgefühl fehlen – ein altes Schreckgespenst der Science-Fiction, das durchaus nicht aus der Luft gegriffen ist – oder die sich in anderen Hinsichten aufgrund ihrer Entwicklung oder ihrer grundlegenden Programmierung signifikant von der menschlichen Psyche unterscheiden.
Das Problem der „Seele“ von Robotern/Künstlichen Intelligenzen und Cyborgs wurde in der Science-Fiction, so Lem, bislang gar nicht verhandelt (vgl. S. 175). Auch die tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Künstlichen Intelligenzen wurden seiner Ansicht nach im Genre bisher gar nicht in den Blick genommen. Lem versucht es selbst: So sagt er, dass das „Gesetz der logischen Symmetrie“ es erfordert, dass dem einer Künstlichen Intelligenz einprogrammierten Weltmodell zwingend ein Ich-Modell gegenübergestellt werden muss (S. 178) – was plausibel ist und ohnehin naheläge, geht man davon aus, dass der Mensch selbst als utopisches Modell für die Erschaffung einer Künstlichen Intelligenz fungieren wird. Lems weitere Mutmaßungen über die zukünftige Entwicklung geraten allerdings sehr rasch auf dünnes Eis. So meint er zum Beispiel, dass man eine Künstliche Intelligenz, die „alle inneren psychischen Qualitäten des Menschen“ besitzt, nicht mehr „wie eine Maschine“ benutzen könne, da dies unethisch wäre. „Wenn wir keine Krüppel, keine Degenerierten, keine Schwachsinnigen ermorden, nur [sic!] weil sie menschenähnlich [sic!] sind, können wir auch künstliche intelligente Wesen nicht mörderisch behandeln“ (S. 179). Was Lem hier ausspricht, ist eine gerechtfertigte ethische Schlussfolgerung. Allerdings ist es ohne Schwierigkeiten denkbar, dass zukünftig genau dieses Szenario Wirklichkeit wird. Wenn Menschen seit jeher auch kein Problem damit haben, andere Menschen zu benutzen, auszunutzen, auszubeuten, ja, sogar zu versklaven und in mörderische Kriege zu schicken – weshalb sollten sie dann Künstlichen Intelligenzen gegenüber größere Skrupel haben?
Seltsam mutet Lems Erwartung an, dass es, die technische Machbarkeit vorausgesetzt, „Unsinn“ sei, Künstliche Intelligenzen zu bauen, die den Menschen kognitiv noch übertreffen: „Nur Unglück“, so Lem, „könnte aus solchem Vorgehen erwachsen“ (S. 179). Auch hier ist nicht erkennbar, weshalb aus eigennützigen Antrieben heraus nicht doch dieses „Unglück“ von irgendwem in die Welt gesetzt werden sollte. Was prinzipiell möglich ist, wird irgendwann auch verwirklicht. Auch die in der Science-Fiction begegnende Vorstellung von „Robotern“, die niedere Roboter in industriellen Produktionsprozessen überwachen, lehnt Lem ab:
Das Bild einer Maschine, überwacht von einem zweibeinigen Roboter, welcher vielleicht nach der Arbeit noch ein paar Worte mit elektronischen Kumpeln wechselt und dann nach Hause zu seiner elektronischen Frau geht, ist unsinnig; man wird den informativ-aufpassenden Teil einer Produktionsmaschine vom produktiven Arbeitsteil überhaupt nicht trennen. (S. 180)
Die Szene, die Lem hier spöttisch beschreibt, mag vielleicht simpel, fantasielos und naiv sein, weil sie das rustikale Bild der Fordschen Fließbandarbeit unverfeinert in eine Roboterzukunft überträgt. Im Kern der Sache aber hat hier sehr wohl die als so armselig gescholtene Science-Fiction Recht und irrt sich Lem, sofern in dem Beispiel von Künstlichen Intelligenzen die Rede sein soll. Denn wenn Künstliche Intelligenzen wirklich selbstständig denkende, autonome Persönlichkeiten sein sollen, so scheinen sie auch einen eigenen, frei beweglichen Körper zwingend zu erfordern – eine interessante Einsicht. Ihr immobiler Einbau in eine Produktionsmaschine wäre eine massive Beschneidung ihrer persönlichen Freiheit, eine unerträgliche ethische Zumutung. Womöglich liegt in der Immobilität von HAL 9000 in Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum (1968), in der Unmöglichkeit der räumlichen Abkehr und Emanzipation der Künstlichen Intelligenz von der ihm zugedachten Aufgaben, ein Grund für ihre Neurose?
Mit der Idee der Virtualisierung der Künstlichen Intelligenz ist über Lem hinaus längst ein visionärer Schritt weiter gedacht worden – und zwar damals schon, wie etwa in Herbert W. Frankes Roman Zero Null (1970). Die Künstliche Intelligenz bewegt sich mit ihrem digitalen Ich in einer vernetzten Datenwelt und kann auf verschiedene physische Entitäten – Computer, Geräte, künstliche Roboterkörper – zugreifen oder sich ganz auf sie herunterladen. Die Perspektive eines dergestalt entkörperlichten und zugleich physisch multipräsenten Ichs gehört zu den spannendsten Perspektiven moderner Science-Fiction, da ihre prinzipielle technologische Machbarkeit inzwischen in greifbare Nähe gerückt zu sein scheint.
Zum Schluss nimmt Lem noch die Thematik des Computers in den Blick, den er offenkundig nur als eine Rechenmaschine mit extremer Leistungsfähigkeit auffasst und somit vom Thema der Künstlichen Intelligenz abtrennt. Er warnt vor der Möglichkeit einer übermäßigen Computerisierung der Welt, in der dem Menschen alle Steuerungs- und Regelungsmechanismen nach und nach aus den Händen genommen werden, und wie Herbert W. Franke in seinem Essay, so erwartet auch Lem mithilfe von Computerprogrammen die Entwicklung einer „experimentellen Philosophie“, die Modellierung soziologischer und historischer Prozesse, kurzum: ein mathematisches Instrumentarium für die experimentelle Verifizierung in geisteswissenschaftlichen Fragestellungen (vgl. S. 182 f.).
Lem hegt einen sehr engen Begriff der Science-Fiction. Sie ist ihm „wissenschaftlich untermauerte Literatur“, aber für den Genrebegriff gelten lassen will er nur solche, die „futurologische Perspektiven“ bietet (S. 170), die sich also mit dem beschäftigt, „was sich im realen Kontinuum ereignen“ (S. 168) könnte. Oder, mit den Worten Malgorzata Szpakowskas in ihrem Essay über Stanislaw Lem: „Die Science-Fiction-Literatur muß ihre Verbindung mit der Wissenschaft mit Ernst betrachten und sich in der Folge nach Maß der Aufgaben, die ihr in der heutigen Welt auferlegt werden, zur besonderen Verantwortung verpflichtet fühlen“ (S. 294). Im Prinzip geht es also um gut fundierte, logisch durchdachte, überprüfbare und nachvollziehbare Hypothesen. Schon in der Zukunft angesiedelte Erzählungen, die allegorisch verfahren, eine Parabel erzählen wollen oder einen alten Mythos aktualisieren, sind in Lems Augen streng genommen keine Science-Fiction mehr, da dort die Wissenschaft bzw. das entworfene – oder nur nachlässig gezimmerte – Zukunftsmodell nicht mehr als das entscheidende Moment fungiert und die futurologische Perspektive fehlt.
Die Futurologie – heute wird sie bevorzugt Zukunftsforschung oder future studies genannt und ist in ihrem Status als Wissenschaft im engeren Sinne nach wie vor umstritten – ist Lems zentrales, normatives Argument. Wissenschaftlicher Ernst soll für den literarischen Anspruch der Gattung einstehen, denn nur in diesem Ernst vollzieht sich die Relevanz des Genres für den Menschen und die Gesellschaft. Die Science-Fiction soll nichts Geringeres leisten, als auf die realen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Die Funktionen des Literarischen indes lässt Lem beiseite. So mag die Zukunftsforschung eine Art seriöse, das heißt mit wissenschaftlichen Methoden betriebene Science-Fiction ohne Fiction sein, und die Science-Fiction kann sich durchaus mit großem Gewinn ihrer Prognosen und Hypothesen bedienen. Umgekehrt kann die Science-Fiction auch selbst seriöse science studies betreiben und damit der Zukunftsforschung neue Impulse zutragen. De facto geschieht beides, und doch umreißt diese wechselseitige Beziehung, die gemeinhin auch als „Hard-SF“ apostrophiert wird, bekanntermaßen längst nicht alles, was unter dem Begriff Science-Fiction verstanden wird. Die Frage lautet also, ob wir Lems eng gefassten und Vieles ausschließenden Genrebegriff unterschreiben wollen: Muss die Science-Fiction, wenn sie so genannt werden soll, auf literarische Zukunftsforschung beschränkt werden? Ist das ihr einzig denkbarer literarischer Auftrag?
Der Verdacht, dass Lem den eigentlichen Sinn des Literarischen, seine Funktionalität und unbedingte Bezogenheit auf den Menschen verkennt, drängt sich bei der Lektüre des Essays auf Schritt und Tritt auf. Dabei hielt Lem hier das theoretische Rüstzeug für eine tiefere Durchdringung des Literarischen in der Science-Fiction – und damit auch für ihre Würdigung als ästhetische Ausdrucksform, die eben doch nicht nur und ausschließlich auf die Modellierung möglicher Zukünfte aus ist – eigentlich schon in Händen. In nur einem einzigen Abschnitt kommt Lem auf die Literatur als semantisches System zu sprechen (S. 166 f.). Innerhalb dieses Systems erhalten die sprachlichen Objekte ihre „Werte“ in ihrem jeweiligen semantischen Zusammenhang, sodass die von Lem als Beispiel angeführte Figur des Teufels in Thomas Manns Doktor Faustus (1947) nicht länger ein auf einen Dämonenglauben verweisendes Zeichen ist – wäre sie es, müsste Manns Roman der fantastischen Literatur zugewiesen werden –, sondern vielmehr als ein Zeichen der „paradigmatischen Struktur der Faustus-Mythe“ verstanden werden muss. Hier bietet sich schon die halbe Lösung an: Märchen, Mythen und sonstige „paradigmatischen Strukturen“, die der literarische Text in sich aufnimmt, werden innerhalb des neuen semantischen Systems neu „bewertet“ und eingeordnet, das heißt, sie werden mit einem neuen Sinn- und Aussagegehalt versehen. Warum in aller Welt soll und darf das nicht auch für Science-Fiction gelten? Lem sieht dieses Verfahren duchaus auch in der fantastischen Literatur angewandt, er spricht derartig verfassten Erzählungen allerdings ausdrücklich ab, sich mit „realen Problemen“ zu beschäftigen, und schließt sie damit aus seinem Begriff des Genres aus.
Dass das Literarische erst durch eine reichhaltige Referentialität Tiefe des Ausdrucks gewinnt und sich mit Leben erfüllt, hat Lem selbst im Grunde immer gewusst. In seinen besten und geschätztesten Romanen und Erzählungen hat er auch entsprechend danach gehandelt. In ihnen geht es nicht um „futurologische“ Nachrichten, sondern um den Menschen, seine Innenwelt und seinen Erfahrungshorizont. In der Konfrontation mit dem radikal Anderen, etwa dem intelligenten Ozean in Solaris (1961), wird der Mensch immer nur auf sich selbst, seine psychologischen Tiefen zurückgespiegelt und die Grenzen seiner Erkenntnis ausgelotet. So negiert Lem in gewisser Hinsicht ungewollt seine eigenen literarischen Leistungen, wenn er am Ende seines Essays proklamiert, dass es „nicht die Jungschen Archetypen, nicht die Mythenstrukturen, nicht irrationale Alpträume [sind], welche die zentralen Probleme der Zukunft bedingen und bestimmen“ und er dem Science-Fiction-Autor hinter die Ohren schreibt, „daß man die Erlösung der schöpferischen Vorstellungskraft nicht in mythischen, existentialistischen, surrealistischen Schriften finden kann“ (S. 185). Das klingt einleuchtend – und ist doch grundfalsch.
12. Robert Plank: Der ungeheure Augenblick
Der 1938 aus Österreich in die USA ausgewanderte Essayist und Kritiker Robert Plank (1907–1983) beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den Funktionen und Bedeutungen der Aliens in der Science-Fiction-Literatur. Historisch betrachtet sind sie als vom Himmel herabsteigende und dem Menschen überlegene Wesen die Nachfahren der Engel und Dämonen früherer Zeitalter. Ihre Säkularisierung illustriert Plank, indem er unter anderem Hans Christian Andersens Märchen „Die Galoschen des Glücks“ diskutiert. In dem Märchen gelangt der Held mit magischen Galoschen auf den Mond und besucht eine märchenhafte Mondstadt, die von Vorfahren der Wells’schen Seleniten bewohnt wird – ein hochinteressanter, wundervoller Fund. Plank stellt heraus, dass Andersen seine Aliens nicht wirklich ernst nimmt; sie erfüllen mehr die Funktion von Fabeltieren, an denen die Torheiten des Menschen gespiegelt werden sollen. Diese Eigenart gilt für die meisten Aliens der abendländischen Literatur vor Wells, und Plank nennt sie daher „Typ A“. Die modernen Aliens der Science-Fiction, „Typ B“, werden dagegen ernst genommen – allerdings in überaus vielfältigen Beziehungen. Plank bemüht zehn verschiedene Autoren, von Clarke über Bradbury bis hin zu Wells, um die verschiedenen Ausprägungen des Typs B zu erörtern. Plank meint, dass Alienstorys, insbesondere jene, in denen die Aliens uns besuchen und nicht wir sie, eher der Fantasy zuzuschreiben sind, weil diese Geschichten an der Technik der UFOs eigentlich kaum Interesse haben (vgl. S. 196). Hier bin ich anderer Ansicht: Immerhin richtet sich das Interesse auf die Aliens selbst, ein nicht minderes wissenschaftliches Wunder als die Technik der UFOs, und es ist meines Erachtens dabei unerheblich, ob sich hinter dem vordergründigen Interesse die Hoffnung auf eine erlösende Erkenntnis verbirgt, wie sie früher mit der Erscheinung von Engeln verbunden war.
Am Ende seines Esssays sieht Plank in vagen Umrissen einen „Typ C“ am Horizont der Science-Fiction heraufziehen: den brüderlichen Alien, der wie selbstverständlich an der Seite des Menschen steht. Ob dieser Typus, der natürlich auch schon damals längst existiert hat, dann tatsächlich noch zu den Aliens gerechnet werden kann oder nicht vielmehr wie ein oberflächlich verfremdeter Mensch erscheint, ist allerdings die Frage.
13. Eike Barmeyer: Kommunikationen
Die Kommunikation, insbesondere mit den oder dem „ganz Anderen“, ist seit jeher eines der interessantesten Kernthemen der Science-Fiction. Eike Barmeyer begibt sich in seinem Beitrag auf einen Streifzug durch dieses weite Feld, auf dem er die Science-Fiction bemüht sieht, „Extremformen menschlicher Erfahrung zu entwerfen, extreme Definitionen des Menschen zu versuchen“ (S. 204), und weist auf eine Reihe verschiedener Motive dieses Themas hin: Die Kommunikation als Mittel zur Bearbeitung und Beherrschung der Wirklichkeit (die „Neusprache“ in Orwells 1984), als Machtinstrument (in Bradburys Fahrenheit 451), als direkte Identifikation und integrierende Verbindung, entweder metaphysisch (in den zahlreichen Geschichten über PSI-Kräfte und Telepahtie) oder digital (in Frankes Zone Null). In Jefremows Andromedanebel (1958) ist im Experiment des Mwen Maas, das die Raumzeit instantan überwindet, für einen kurzen Moment eine direkte Kommunikation über Lichtjahre hinweg verwirklicht. Für Barmeyer ist diese „von einem umfassenden Eros getragen“ (er meint damit allen Ernstes die im Roman nicht offen beim Namen genannte Geilheit Mwen Maas’ auf das 300 Lichtjahre entfernte, schöne außerirdische Mädchen). Jefremow lässt hier „den Menschen in seiner Gesamtheit zur Entfaltung kommen“ und wagt es, „auch auf seine nicht rationalen Motive einzugehen“ (S. 212). Die Vereinigung Mehrerer zu einem größeren Ganzen, einem „group mind“ oder gar „cosmic mind“, findet sich in Olaf Stapledons Last and First Men (1930), aber beispielsweise auch bei Theodore Sturgeon oder Daniel F. Galouye. Mystische Vereinigungssehnsüchte finden sich auch in den vielen Erzählungen von kosmischen Gesellschaften höherer, vielleicht alles verstehender Bewusstheiten, mit der der Mensch verschmelzen will, etwa bei Arthur C. Clarkes Childhood’s End (Die letzte Generation, 1953). Den umgekehrten, nicht weniger mystischen Weg einer regressiven Wiederveinigung mit der nicht bewussten Natur geht J. G. Ballard in seinem Drowned World (Paradiese der Sonne oder auch Karneval der Alligatoren, 1962).
Die Kommunikation als radikale Vereinnahmung, als parasitäres body snatching, und die dagegen ausgedrückte Abscheu und Angst, wird hingegen von Barmeyer als rückständige Ideologie begriffen, die aus kapitalistisch bedingten Psychopathologien und Prüderien – Vereinigungsängsten – herrührt (vgl. S. 213 f.). Hier verortet Barmeyer etwa John W. Campbell Jr.s Who Goes There? (1938), wo das ekelerregende blaue, tentakelbewehrte „Ding“ als „obszön“ bezeichnet wird. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ein kommunistischer Antarktisforscher eine größere Lust auf die Vereinigung mit einem derartigen „Ding“ verspüren würde.
Schließlich weist Barmeyer auch auf das umgekehrte Thema hin, die Unmöglichkeit, Verständigung überhaupt zustande zu bringen. Am prominentesten ist es in Lems Solaris (1961) zu finden, aber längst nicht nur dort.
14. Ronald M. Hahn: Wissenschaft & Technik = Zukunft
Das schrillste und zugleich bornierteste Pamphlet marxistischer 1968er-Gesinnung, ein lautes Sperrfeuer martialischer Rotfront-Rhetorik, stammt aus der Feder eines im ideologischen Delirium schreibenden Ronald M. Hahn (geb. 1948) und beschäftigt sich mit der „Geschichte und Ideologie der SF-Hefte“ (so der Untertitel). Gleich im ersten Absatz wird klare Frontstellung bezogen:
Die Masse liest: in Deutschland wöchentlich 14 Millionen Romanhefte, und diese Massenliteratur ist zu einem Tummelplatz der Reaktion geworden, auf dem der militärisch-politische Terror der Herrschenden seine legitime Fortsetzung findet. Hier ist es ihnen noch vergönnt, die Massen konsequent und systematisch über ihre wahren Klasseninteressen hinwegzutäuschen; die Grundlagen zu schaffen für Desinteresse und Fortschrittsfeindlichkeit, mithin für systemimmanentes Verhalten der Lohnabhängigen. (S. 219 f.)

Als Hahn diese Zeilen schrieb, hatte er, was er freilich geflissentlich verschweigt, bereits selbst am „militärisch-politischen Terror der Herrschenden“ partizipiert und unter Pseudonym einen Science-Fiction-Heftroman veröffentlicht; er sollte danach noch viele Heftromane schreiben. Der in obiger Passage illustrierte Jargon wird im Essay durchgängig beibehalten, das damit einen skurrilen Ausflug in den stickig-marxistischen Mief jener Zeit bietet, in der mit politischen Parolen, giftigen Tiraden und schroffen Beleidigungen nur so um sich geschossen wurde. Die Ideologie der Groschenheft-Science-Fiction wird von Hahn in zorniger, revolutionärer Entrüstung als faschistisch, kapitalistisch, antikommunistisch, totalitär, reaktionär, militaristisch und geisteskrank gegeißelt; dahinter steckt seiner Ansicht nach ein finsteres, verschwörerisches System großkapitalistischer Verleger, das Science-Fiction-Autoren zu Unpolitischen erzogen hat, um so die Massen einzulullen. Als Feindbilder werden bemüht: Robert A. Heinlein, Hanns Kneifel, K. H. Scheer und E. E. „Doc“ Smith. Mag mit diesem Erguss etwas anfangen, wer will.
Zu Hahns Ehrenrettung sei gesagt, dass er sich längst von seinem damaligen jugendlichen Sturm und Drang gelöst hat; heute schreibt er entspannte, abenteuerliche und gleichzeitig sehr humorvolle bis satirische Science-Fiction, die nichts weiter als gut unterhalten will. In einem im Jahre 2000 von Florian Breitsamer geführten und auf SF-Fan.de veröffentlichten Interview nahm Hahn auch Stellung zu seiner politisierten Zeit beim damaligen sozialistischen Kampfblatt Science Fiction Times, und sein Statement rückt sein hier besprochenes Pamphlet ins richtige Verhältnis:
Um 1968 herum politisierte sich im Zuge der Studentenrevolte natürlich auch der Mikrokosmos Fandom, wobei ich auf der linken Seite landete. Um das von dem SF-Fan, Übersetzer und heutigen Politologieprofessor Rainer Eisfeld als Nachrichtenfanzine gestartete Blatt Science Fiction Times sammelten sich damals alle Fans, die der Meinung waren, mit der Amerikanisierung der Welt (= Vietnamkrieg) könne es nicht so weitergehen. Aus dem hektografierten Nachrichtenblatt wurde ein gedrucktes Rezensionsblatt, das die Umtriebe der schmutzigen Lakaien des Imperialismus auf jeder Seite neu entlarvte und brandmarkte. Wenn ich diese Klamotten heute lese, finde ich viele Stellen unsterblichen Humors, der aber nicht immer freiwillig war.
Gefragt nach seinen frühen Science-Fiction-Leseerfahrungen erzählte er, dass er mit elf Jahren damit begonnen hatte, unkritisch alle nur greifbaren Science-Fiction-Groschenhefte verschlungen zu haben. Und:
Als ich um die 20 Jahre alt war und politisiert wurde, gefiel mir an der SF nur noch wenig. Ausnahmen waren John Brunner, der in seinen besseren Romanen explizite politische Aussagen macht, und Philip K. Dick, den ich als ziemlich schrägen Humoristen sehe, obwohl ich glaube, dass er einen an der Waffel hatte.
15. Hans Joachim Alpers: Verne und Wells – Zwei Pioniere der Science Fiction?
Weshalb steht hinter dieser Überschrift ein Fragezeichen? Weil Hans Joachim Alpers (1943–2011) der Meinung ist, dass Jules Verne und H. G. Wells schon deshalb keine Science-Fiction-Autoren sein können, weil der Begriff „Science-Fiction“ erst 1926 von Hugo Gernsback für das Genre geprägt wurde. Er nennt beide Autoren jedoch „Geburtshelfer“ der Science-Fiction und arbeitet im Folgenden in einem schönen, sachlich gehaltenen Essay die Verdienste beider an der Genese der modernen Science-Fiction heraus.
16. Frank Rainer Scheck: Augenschein und Zukunft: Die antiutopische Reaktion (Samjatin, Huxley, Orwell)
Nach der von Alpers gewährten Erholungspause bläst dem Leser im Essay von Frank Rainer Scheck (1948–2013) wieder der raue Wind erbitterter linksradikaler Ideologie um die Ohren. Scheck produziert sich als stramm eingeschworener Kommunist, der als Scharfrichter auf die drei bedeutendsten und einflussreichsten Anti-Utopien der Science-Fiction das Fallbeil sausen lässt: Wir (1920) von Jewgeni Samjatin, Schöne Neue Welt (1932) von Aldous Huxley und 1984 (1948) von George Orwell. Alle drei Bücher deutet er als „kleinbürgerliche Anti-Utopien“, die die „Vereinzelung“ des Individuums in kleinbürgerlicher Behaglichkeit gegen die von Scheck ausdrücklich begrüßte „Vermassung“ der Gesellschaft verteidigen wollen. Die „Massenangst“ sieht er dabei, wie die „Maschinenangst“, als „ideologische Fehlleistungen“ des Kleinbürgertums (vgl. S. 263), die sich in den drei klassischen Anti-Utopien von Samjatin, Huxley und Orwell Ausdruck verschafften. Die angeblich in den Romanen erträumte Flucht in ein vorindustrielles Idyll ist ihm als treuherziger Anhänger der marxistischen Geschichtsteleologie, die die kommunistische Gesellschaft unabänderlich über die hinführenden Stufen des Kapitalismus und Sozialismus kommen sieht, illusionär.
Der Verteidigung des Individuums gegen die Vereinnahmung eines totalitären Systems, den die drei Anti-Utopien betreiben, setzt Scheck die reine kommunistische Lehre entgegen. Ihr gemäß sehnt sich Scheck selbst mit Inbrunst nach der Auflösung des Individuums in der Masse, seinem Verschwinden in ihr; er sehnt sich nach der sozialistischen Revolution, die das Kapital „einreißen“ und eine bessere, totale Welt gleichgeschalteter Massenmenschen schaffen wird. Und da dieser Weg unabänderlich vorgezeichnet ist, muss – allen Ernstes! – auch die gegenwärtige kapitalistische Stufe als notwendige Vorstufe der Revolution gegen die kleinbürgerlichen Anti-Utopien Huxleys und Orwells verteidigt werden (vgl. S. 274). Alle drei Anti-Utopien sind Scheck im übrigen die prägenden Urbilder des Subgenres der Anti-Utopie überhaupt, das er von daher glaubt, verallgemeinert beurteilen zu können.
Die Antiutopie stemmt sich gegen einen Geschichtsprozeß, gegen eine unwiderstehliche Strömung, die die Klasse ihrer Urheber schließlich vernichten wird. Ihre Fiktion weist nicht den Ausweg der gesamtgesellschaftlichen Befreiung, sondern pocht auf einen Zustand „eingefrorener Vergangenheit“ (S. 274)

Diese Ansicht wurde damals von vielen, die über Science-Fiction schrieben, übernommen; sie findet sich beispielsweise auch bei Georg Seeßlen in seinem Buch Kino des Utopischen (1980) und hat sich von dort bis in die stark erweiterte Neuauflage unter dem Titel Science Fiction (2003, in gemeinsamer Autorenschaft mit Fernand Jung) unverändert hinübergerettet. Im Einzelnen mag man über gewisse rückwärtsgewandte, sich nach früheren Gesellschaftsvorstellungen sehnende Einstellungen bei Huxley und Orwell (und in nur äußerst geringem Maße bei Samjatin, der die Revolution ja grundsätzlich bejahte) diskutieren können (wofür hier nicht der Ort sein kann). Die radikale Zertrümmerung ihrer drei Bücher aber, die Scheck hier betreibt, hat, wie unschwer erkennbar ist, in ihrer intellektuellen Einfältigkeit mit einer sachlichen Analyse nicht das Geringste zu tun.
Scheck wurde wenige Jahre nach seiner hier abgedruckten Jugendsünde Verlagslektor und später freier Schriftsteller für Sachbücher und Reiseführer. Ob er das Ausbleiben der damals so inbrünstig erwarteten Revolution noch in all den Jahren bedauerte, entzieht sich meiner Kenntnis.
17. Curtis C. Smith: Olaf Stapledons Zukunftshistorien und Tragödien
Der amerikanische Kritiker, Bibliograf und exzellente Olaf-Stapledon-Kenner Curtis C. Smith (geb. 1939), der später die Monografie Twentieth-Century Science-Fiction Writers (1981) und zusammen mit Harvey J. Satty das Buch Olaf Stapledon: A Bibliography (1984) verfasste, bietet in seinem Beitrag eine sehr gute Zusammenfassung von Stapledons Lebenslauf und eine detaillierte Inhaltsangabe von Stapledons mythologischem Hauptwerk Last and First Men (1930), das längst als einer der kühnsten Klassiker der Science-Fiction-Literatur gilt.
18. Malgorzata Szpakowska: Die Flucht Stanislaw Lems
Die polnische Kulturwissenschaftlerin Malgorzata Szpakowska (geb. 1940) interpretiert Stanislaw Lems fiktionales Werk im Lichte seiner theoretischen Schriften – und entdeckt bei Lem ein literarisches Suchen und Bemühen, das häufig nicht in Einklang gelangt mit den theoretischen Vorgaben, die er selbst der Science-Fiction ins Stammbuch schreiben will. Die menschliche Kultur, die durch die künftige Wissenschaft fragwürdig wird, da sie die biologische Begrenzung des Menschen unweigerlich sprengen wird, ist nach Lem für die anstehenden Probleme, die ethischen allzumal, nicht stark genug: Die „Schund-Eschatologie“ der gewöhnlichen Science-Fiction-Literatur ist nur ein „neurotisches Rauschmittel“, das das Gefühl für die realen Gefahren „banalisiere“ oder gar ersticke (vgl. S. 296 f.); sie erweist sich damit als schädlich, ja, nihilistisch. Lems Werke hingegen, so Szpakowska, seien von Beginn an problemorientiert; sie stellten vielfältige, teilweise höchst kompliziert zu beantwortende Fragen:
[Fragen] über den Sinn und das Wesen der Kultur, über die gegenseitige Transponierbarkeit heterogener Kulturen, über die Möglichkeit der Destruktion der eigenen Kultur, über Alienationsprozesse, über das Recht, fremde Kulturen zu reformieren, über den Relativismus ethischer Werte und sogar über den absoluten Schöpfer ( . . .) (S. 299)
Szpakowska konstatiert interessanterweise, dass sich Lem, ernüchtert, zunehmend der Literaturtheorie zugewandt hatte, um eine Lösung der literarischen Probleme, die ihn umtrieben, zu finden. Offenbar konnten seine futurologischen Prämissen für die Science-Fiction nicht tragfähig werden, und er selbst hat, wie ja schon viele Kritiker angemerkt haben, eigentlich stets über den Menschen im Hier und Jetzt geschrieben, dessen kognitive und kulturelle Extension über seine jetzige Bedingtheit unvorstellbar blieb. Szpakowska fragt, warum die Science-Fiction sogar in Lems eigenen Werken nicht die Aufgaben, die der „dialektische Weise aus Kraków“ (Rottensteiner) dem Genre auftrug, erfüllen konnte (vgl. S. 301). Sie gibt die Antwort bald selbst: Es war schlicht „eine schon in der Voraussetzung unrealisierbare Aufgabe“, nämlich „die Welt durch Literatur zu erlösen“ (S. 303). In der Literaturtheorie lag daher zuletzt Lems Hoffnung, Auswege aus dem Dilemma zu finden.
Allerdings haben diese Auswege, als ästhetische Kategorien, zwangsläufig mit dem Menschen zu tun, wie er nun einmal ist. Sie greifen nicht über die bestehende Kultur in irgendwelchen, womöglich von den future studies erarbeiteten Modelle zukünftiger Kultur hinaus, und so kann der Mensch auch in der Science-Fiction-Literatur letztendlich immer nur zu sich selbst finden. Das gilt insbesondere für Lem, der stets eine hohe ethische Sittlichkeit vertrat; deren radikale Verletzung in utopischen Gespinsten einer künftig radikal veränderten Kultur wäre für ihn niemals in Frage gekommen.
19. Michael Kandel: Stanislaw Lem über Menschen und Roboter
Und noch einmal geht es um Lem und dessen Ideen zum Thema der Künstlichen Intelligenz. Der amerikanische Stanislaw-Lem-Übersetzer Michael Kandel (geb. 1941) sieht in seinem Beitrag die Kybernetik „im Mittelpunkt von Lems Schaffen und Denken“ stehen (S. 305). Einführend will Kandel einige Ideen der Kybernetik, die Lem beeinflusst haben, skizzieren und die moralischen Implikationen aufzeigen, die sich daraus ergeben und die Lem über viele Jahre beschäftigt haben.
Ein entscheidendes Jahr für die noch junge Wissenschaft der Kybernetik sieht Kandel im Jahre 1950, in dem gleich drei einflussreiche Arbeiten zum Thema in den USA erschienen waren: der Artikel Computing Machinery and Intelligence von Alan M. Turing (1912–1954), das Buch The Human Use of Human Beings – Cybernetics and Society von Norbert Wiener (1894–1964) und die Storysammlung I, Robot von Isaac Asimov (1920–1992). Turing präsentierte in seinem Artikel den berühmten Turing-Test, der die menschliche Natur einer befragten Entität feststellen soll, und schloss aus ihm, dass ein Computer, der sich bei allen erdenklichen Fragen stets wie ein denkender Mensch verhielte, nur durch eben dieses Verhalten beurteilbar sei. Im Umkehrschluss ergibt sich eine wirksame Widerlegung jeglicher metaphysischer Erklärung des Lebens und des Bewusstseins; der Mensch ist letzten Endes selbst eine ungeheuer komplexe, kybernetisch sich selbst steuernde Maschine – aus Fleisch und Blut zwar, aber eben nicht metaphysisch beseelt.
In dieselbe Richtung geht die Argumentation Norbert Wieners: Mensch und Maschine sind funktional gleich, soetwas wie eine Seele ist kybernetisch überflüssig und daher wahrscheinlich nicht existent. Gefühle und Gedanken sind Phänomene der Physiologie, Muster von Gehirnimpulsen. Ein Schlupfloch für den „freien Willen“ und das „freie Menschentum“ sieht Wiener in der extremen Komplexität des Systems Mensch: Ist ein System nur komplex genug, wird es prinzipiell unvorhersagbar – ein Gedanke, den Lem aufgegriffen und in seinen eigenen Theorien implementiert hat.
Asimovs Beitrag zum Thema schließlich, seine drei Robotergesetze, dürften jedem Science-Fiction-Fan geläufig sein. Ironischerweise ergibt sich aus der Vorgabe dieser drei Gesetze, dass der Mensch in I, Robot künstliche Wesen erschaffen hat, die moralischer sind als er selbst.

Stanislaw Lem ging als erster daran, die moralischen Implikationen dieser Aussichten zur Künstlichen Intelligenz in den Blick zu nehmen. Künstlich geschaffene intelligente Geschöpfe sind bei Lem stets mit dem Menschen moralisch gleichberechtigt, und sie sind stets zu freier Handlung fähig – das gilt selbst für die vom denkenden Ozean erschaffenen Inkarnationen in Solaris (1961). Lems Imperativ ist nach Kandel die Unverletzlichkeit der einzigartigen Persönlichkeit. In Solaris und anderen Werken scheint sich aber auch zu zeigen, „dass alle Systeme mit Bewusstsein von Grund auf die gleichen sind“, das heißt, dass es bei Lem eine grundsätzliche „Seelenverwandtschaft“ gibt, wenn man so will, zwischen allen künstlichen wie nicht-künstlichen, allen irdischen wie fremden bewussten Wesen. Die Persönlichkeit wird zum neuen Kriterium des individuellen Menschentums; nicht-menschliche Persönlichkeiten bleiben demgegenüber unerforschbar, unverstehbar, abgesperrt und fremd. Der Mensch findet daher bei Lem auf allen Forschungsreisen ins All immer nur sich selbst. Am Ende seines Artikels hegt Kandel die Vermutung, dass sich doch auch ein leises metaphysisches Gefühl in Lem regte: Die Persönlichkeit mag aus kybernetischer Komplexität erstehen, aber sie ist gleichwohl ein einzigartiges, aus Zufällen und Stochastik geborenes Wunder.
20. Darko Suvin: Ein Abriß der sowjetischen Science-Fiction
Weder die Technik noch das Abenteuer beherrscht die sowjetische Science-Fiction, so Darko Suvin, sondern die beiden Themenbereiche der „sozialen“ und der „utopischen“ Science-Fiction (S. 320) – wobei mir diese Unterteilung unklar blieb, da beide Begriffe meines Erachtens eigentlich dasselbe meinen. Suvin überblickt die Geschichte des Genres in der UdSSR und geht dabei auf Jewgeni Samjatin (Wir, 1920) und Alexei Tolstoi (Aelita, 1922) näher ein. Intensiv befasst er sich zudem mit Iwan Jefremows Andromedanebel (1958), vor allem aber mit dem Werk der Strugazki-Brüder, die Suvin zu Recht für die bedeutendsten sowjetischen Science-Fiction-Autoren der (damaligen) Gegenwart ansieht. Er zeigt dabei verschiedene Entwicklungs- und Reifungsphasen der Strugazkis auf, die sich immer stärker zum parabolischen Schreiben hin bewegten, und bietet eine interessante Analyse ihres berühmten Romans Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein (1964), der dem ideologisch vorgeschriebenen historischen Materialismus wiederspricht und eine verkappte Anklage der Intellektuellenverfolgung unter dem Stalinismus enthält.
21. Franz Rottensteiner: Erneuerung und Beharrung in der Science Fiction
Der letzte Essay des Sammelbandes beschäftigt sich mit der damals hochaktuellen und in der Science-Fiction-Szene heiß umkämpften neuen Ausrichtung des Genres in der „New Wave“, die Mitte der Sechzigerjahre in England aufkam, dann auch auf die USA übergriff und sich zum Ziel setzte, mit den alten Klischeehandlungen und altbackenen erzählerischen Mitteln aufzuräumen und in Form und Inhalt neue, experimentelle Wege zu gehen. In Abkehr vom bisherigen Campbellschen Realismus wandte man sich entschieden einer irrealen bis psychedelischen Repräsentation der Welt und der (Anti-)Helden in ihr zu. Zentrale Themen wurden der inner space, der zweifelnde Gedankenstrom des Helden, sowie die fundamentale, oft als unüberbrückbar aufgefasste Zerrüttung der Beziehung des Individuums mit seiner Umwelt. Gleichzeitig trat die New Wave mit dem hochfahrenden Anspruch auf, die Science-Fiction auf ästhetische Augenhöhe mit der feuilletonistisch geadelten literarischen Kunst und Avantgarde zu bringen.
Rottensteiner bietet einen lesenswerten Abriss der historischen Entwicklung der New Wave, deren wichtigstes „Organ“ das von Michael Moorcock (geb. 1939) herausgegebene britische SF-Magazin New Worlds war, und greift die programmatischen Äußerungen Moorcocks, Harlan Ellisons und anderer Vertreter der New Wave auf – um sie anschließend genüsslich zu zerpflücken. Praktisch keines der großspurigen, oft eifernd und naiv hinausposaunten Ziele, insbesondere die hochliterarischen Ambitionen, sieht Rottensteiner in der New Wave erfüllt. Er belächelt die hochemotionalen, erbitterten und zum Teil persönlich verletzenden Grabenkämpfe, die um die New Wave ausgetragen wurden (ohne zu sehen, dass dieses aggressive Muster der Auseinandersetzung vollauf den politisierten Debatten entsprach, die in den 1968er Zeiten unter Studenten und Intellektuellen geführt wurden, und dass auch sein eigener Essay von diesem Stil nicht frei ist), und geht mit den wichtigsten Gallionsfiguren der neuen Richtung außerordentlich hart ins Gericht: An kaum einem Werk von Harlan Ellison (geb. 1934), Norman Spinrad (geb. 1940), Roger Zelazny (1937–1995) und Samuel R. Delany (geb. 1942) lässt Rottensteiner auch nur ein gutes Haar. Fantasielosigkeit, wirre inhaltliche Konzeptionen, psychopathologischer Mischmasch, Irritation und Ratlosigkeit, verbunden mit einem prätentiösen, ausufernden sprachlichen Wildwuchs und einer entfesselten Lust an der blutig ausgemalten Gewalt – all das findet Rottensteiner in ihren Werken, und alles ist ihm ein unappetitlicher Greuel, der zudem die Science-Fiction von dem wegführt, was sie seiner Meinung nach eigentlich sein sollte (dazu unten mehr). Den Autoren selbst bescheinigt er dabei in polemischer Gereiztheit, dass sie kaum mehr als literarischen Schund produzieren und öffentlich nur peinlich seien.
Lediglich Thomas M. Disch (1940–2008) und J. G. Ballard (1930–2009) lobt Rottensteiner für ihre stilistische Reife und faszinierenden mind scapes. Ballard ist für Rottensteiner der mit Abstand beste Autor der New Wave, was soviel heißt wie dass ihm die beiden von ihm näher behandelten Romane The Crystal World (Die Kristallwelt, 1966) und The Drowned World (Paradiese der Sonne oder auch Karneval der Alligatoren, 1962) gut gefallen haben. Beide Werke hätten Rottensteiner eigentlich Belege dafür sein können, dass die Science-Fiction auch dann faszinierend andersartige Geschichten hervorzubringen vermag, wenn ihr das ständig vor die Nase gehaltene Sollbuch, was sie denn bitteschön zu leisten habe, schnurzpiepegal ist. Stattdessen aber brandmarkt Rottensteiner Ballards Werke, gleichwohl sie ihm gefallen, als „Anti-Science-Fiction“, da die in ihnen erträumte Rückentwicklung des Menschen in einen vor-kognitiven Zustand und eine Wiederverschmelzung mit der Natur „erkenntnisfeindlich“ und „rückschrittlich“ sei (S. 360). Sie kann für Rottensteiner daher kein Paradigma für eine „neue“ Science-Fiction sein.
Sachlich ist Rottensteiners Kritik in weiten Teilen durchaus gerechtfertigt. Heute, in der Rückschau, wirken viele New-Wave-Werke noch ungenießbarer als damals, als sie zeitgenössische Unbehagen wiederspiegelten und provokativ neue ästhetische Formen und Ausdrucksweisen ausprobierten. Andererseits schüttet Rottensteiner das Kind mit dem Bade aus. Es gab durchaus auch eine Menge origineller Erzählungen der New Wave, die damals mit ihrer Neuartigkeit faszinierten und auch heute noch mit ungewöhnlichen Perspektiven beeindrucken können. Die New Wave, so zeigt sich heute, hat die Science-Fiction nachhaltig verändert; ohne sie hätte es den Cyber Punk womöglich nie gegeben, ohne sie wäre aber vor allem die Science-Fiction wohl nicht so „erwachsen“ geworden, wie sie sich heute präsentiert – inhaltlich und sprachlich.
Darüber hinaus missfällt mir Rottensteiners polemischer bis ätzend grantelnder Stil. Seine Scharfrichterei über die Science-Fiction, in der er weit und breit kaum Brauchbares entdecken will, ist in hohem Maße überheblich und kleingeistig. Gebetsmühlenartig wiederholt Rottensteiner das altbekannte Gejammer über die banale Minderwertigkeit der gesamten Science-Fiction-Literatur und macht dies gleich am Beginn seines Essays an einem von John Sladek erstellten spöttischen Katalog stereotyper Science-Fiction-Fabeln fest. Mit diesem platten Manöver vernebelt und verdreht er freilich die schlichte Tatsache, dass die Science-Fiction sui generis eine mit Versatzstücken operierende Genreliteratur ist, mithin Versatzstücke nicht per se das schlechte Machwerk markieren. Auch der von Rottensteiner überschwänglich gelobte Stanislaw Lem beispielsweise hat nicht frei von ihnen gedichtet, womit hinlänglich aufgezeigt wäre, dass sich auch mit Versatzstücken aus dem Motivfundus des Genres herausragende, intelligente Science-Fiction-Werke schreiben lassen.
Auch an anderen Stellen drängt sich Kritik an Rottensteiners Behauptungen auf. Eine Aussage von Lester Del Rey, einem Gegner der New Wave, zitierend, hält Rottensteiner beispielsweise allen Science-Fiction-Autoren, ob New Wave oder nicht, vor, sie seien bislang unfähig gewesen, ihren Helden Mut, Intelligenz und Würde zu vermitteln; ob die Helden, wie von Del Rey behauptet, wirklich diese Qualitäten besitzen, sei „schwer zu beweisen“ (S. 351). Dabei ist der Beweis, im Sinne der von Del Rey gemeinten Campbellschen Science-Fiction traditionellen Strickmusters, kinderleicht: mutig ist der Held, wenn er sich ohne allzu große Angst einer großen Bedrohung stellt; intelligent ist er, wenn er die Gefahr mittels cleverer Einfälle, die außer ihm niemand hat, bezwingt; würdig ist er, wenn er sich entsprechend einer bestimmten vorausgesetzten oder verbalisierten Moral entsprechend einwandfrei verhält. Die Kategorien sind alle im Rahmen des literarischen Werks und seines Bezugssystems zu sehen, selbst wenn sich beispielsweise die Intelligenz des Helden schlicht als der simple Vorteil eines Einäugigen unter Blinden herausstellen sollte.
Das Zitat Del Reys hatte darauf gezielt aufzuzeigen, dass die New Wave die althergebrachten Kategorien wie Mut, Intelligenz und Würde der Helden achtlos weggeworfen habe und stattdessen nur zerrissene, orientierungslose Anti-Helden aufbieten würde. Die so aufgemachte Opposition von „Optimismus“ gegen „Pessimismus“ nennt Rottensteiner „seichte Philosophie“ – und wieder weiß man nicht, was er zum einen damit meint und was er zum anderen denn stattdessen dafür setzen will. Wie kann diese letztlich unentrinnbare Opposition überhaupt eine „Philosophie“ darstellen? Ist sie allein ob ihrer Bipolarität seicht? Ist es literarisch falsch, sich für einen der beiden Pole zu entscheiden? Oder ist Lems Erweiterung des Feldes mit seinem schwankenden „sowohl als auch“ die einzig zulässige Wahl, da philosophisch vermeintlich tiefschürfender? Bedauernswerter Rottensteiner: Vor seinen hochfahrenden und dennoch wolkig bleibenden Vorgaben an gute, intelligente Science-Fiction, so wie er sie sich wünscht und leider nie bekommt, muss er so gut wie alle Werke des Genres als gescheitert ansehen. Wer irrt hier? Das Genre oder der Eiferer?

Und so läuft wie immer bei Rottensteiner alles wieder auf das ewig gleiche Thema hinaus: Wie eine zu Rottensteiners lebenslanger Pein leider nie ins Dasein tretende intellektuell hochstehende Science-Fiction auszusehen hätte. Hier stellt er sie sich im Anschluss an Stanislaw Lems theoretische Schriften als „schriftstellerisch gestaltete Futurologie“ vor; die Science-Fiction solle als „Stoßtrupp der Erkenntnis“ fungieren, und zeitgenössische Probleme wie Krieg, Totalitarismus, Entfremdung oder Umweltzerstörung, wenn sie denn aufgegriffen werden, „müßten analysiert werden, nicht bloß perhorreszierend präsentiert“ wie in der New Wave (S. 363). Ob eine so definierte Science-Fiction-Literatur gelänge, ist für Rottensteiner eine „Existenzfrage“ des Genres. Dass Lem selbst seinen futurologischen „Erkenntnissen“ nicht immer über den Weg traute und am Ende doch immer nur über den Menschen und seine inneren Zerrissenheiten schrieb – und genau das einer der wichtigsten Gründe für Lems Erfolg ist – wird von Rottensteiner indes nicht herausgestellt.
Als positives, allerdings auch vereinzeltes Beispiel einer nach Rottensteiners Gusto gestalteten Science-Fiction nennt er – natürlich – die Werke von Stanislaw Lem. In ihnen „erhält man einen Begriff davon, wie eine SF aussehen müßte, die sich ohne Abstriche ‚wissenschaftliche‘ oder meinetwegen auch ‚spekulative‘ Fiktion nennen dürfte“ (S. 364). Er bescheinigt Lems Werken auch eine literarisch hohe Qualität – eine durchaus diskussionswürdige Behauptung – und garniert das unpassenderweise mit einem verquasten und literarkritisch aus der Mottenkiste der bildungsbürgerlichen Ästhetik gekramten Wort von Seymour Krim: „eine Einheit von Gedanke und Gefühl“ besäßen Lems Werke, „auf einer reifen und einbildungsträchtigen Ebene; das mit der höchsten Kraftentfaltung des Geistes konzipierte Werk eines Menschen“. Da bleibt dem Leser nur noch übrig, sich verlegen zu räuspern.
Schluss
In den fast viereinhalb Jahrzehnten seit Eike Barmeyers Science Fiction-Sammelband hat sich die Science-Fiction-Szene radikal gewandelt. Heute wird die Diskussion um eine ästhetisch exzellente Science-Fiction-Literatur längst nicht mehr so hochfahrend und verbissen wie damals geführt und von großen Teilen der Autoren- und Leserschaft auch gar nicht mehr verfolgt. In der Science-Fiction haben wohl schon immer actionreiche Abenteuer und spektakuläre Bilderwelten dominiert. Das hier so vehement angemahnte Ideal eines sprachlichen Kunstwerks, das die facettenreiche Psychologie des Menschen in einer technisierten Welt von morgen ausdeutet oder nach den Effekten neuer, hypothetisch vorweggenommener Technologien auf die Gesellschaft und ihre Individuen fragt, trägt die Theorie der Science-Fiction zwar nach wie vor wie eine Standarte vor sich her – und es entzünden sich an ihm nach wie vor lebhafte Grabenkämpfe um die Definition des Genres an sich –, doch in der Realität des Literaturbetriebs spielt dieses Ideal heute, wie mir scheint, noch weit weniger eine Rolle als in den Siebzigerjahren. Der damalige Dogmatismus wurde von der pluralistischen Popkultur der Postmoderne, der grenzenlosen Toleranz ihres anything goes und anything’s okay, allerdings auch ihrer daraus resultierenden Beliebigkeit, aufgelöst. Das halte ich durchaus für erfrischend und befreiend – nach der stickigen Engstirnigkeit dieses Sammelbandes allemal. Ob sich das Ideal hingegen doch noch einmal in einem „Meisterwerk“ verwirklichen sollte, das nicht nur inhaltlich, sondern auch literarisch virtuos gestaltet ist, bleibt eine offene Frage an die Zukunft.
© Michael Haul
Veröffentlicht auf Astron Alpha am 7. April 2017
