Robert A. Heinlein: Sternenkrieger
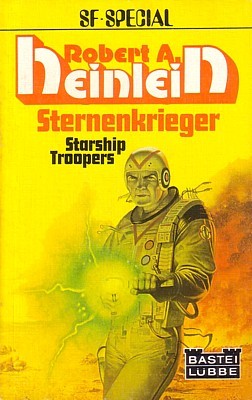
Starship Troopers (1959). Science-Fiction-Roman. In deutsch seit 1979 in mehreren Auflagen im Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe (Bergisch-Gladbach) erschienen. Übersetzung ins Deutsche von Bodo Baumann. 2014 erschien eine deutsche Neuauflage im Mantikore-Verlag als Taschenbuch und E-Book, in neuer Übersetzung von Ulrich Schüppler. Das Bild links zeigt das Cover der mir vorliegenden fünften Auflage vom September 1984. Taschenbuch, 303 Seiten.
In der Zukunft hat sich die gesamte Menschheit zur „Terranischen Föderation“ zusammengeschlossen, einem Staatswesen, in dem die Demokratie fundamental eingeschränkt ist. Das passive und aktive Wahlrecht erhält nur, wer mindestens zwei Jahre freiwilligen Militärdienst geleistet hat; der herrschenden Ideologie gemäß sind nämlich nur jene würdig, politisch mitzureden, die mit dem Dienst ihre Bereitschaft unter Beweis gestellt haben, im Falle eines Krieges die Menschheit zu verteidigen und gegebenenfalls für sie zu sterben.
Der achtzehnjährige, aus einer reichen Familie stammende Juan „Johnny“ Rico lässt sich von seinem Freund Carl dafür begeistern, in den Militärdienst einzutreten – sehr zum Ärger seiner Eltern, die keinen Pfifferling für das Wahlrecht geben würden und es als Tugend ansehen, sich aus der Politik herauszuhalten. Johnny meldet sich im örtlichen Rekrutierungsbüro, und schon zwei Tage später wird er in sein Ausbildungscamp in Marsch gesetzt. Für Johnny beginnt ein erbarmungsloser Drill, dem nur die Stärksten gewachsen sind. Am Ende hält nur ein knappes Zehntel aller Rekruten die Grundausbildung durch. Einige kommen durch Unfälle um, die meisten anderen quittieren frühzeitig den Dienst oder werden aus gesundheitlichen Gründen in niedere Hilfsposten oder Arbeitskolonnen der Armee abgeschoben.
Trotz aller Strapazen, drakonischer Strafen bei Pflichtverletzungen und Gefahren für Leib und Leben dauert es nicht lange, bis sich Johnny bei der Truppe wohlfühlt und sich mit ihrem Chorpsgeist und ihren Werten von Pflichtgefühl, Ehre und Stolz identifiziert. Im interstellaren Krieg der Föderation gegen die „Bugs“, einer insektoiden Rasse, erlebt Johnny seine ersten Kampfeinsätze und bewährt sich. Johnny beschließt, ganz beim Militär zu bleiben und Offizier zu werden, doch die Einsätze werden härter . . .
Ein umstrittener Klassiker
Robert A. Heinlein (1907–1988) zählt zu den bekanntesten, einflussreichsten und meistgeschätzten Science-Fiction-Autoren aller Zeiten und wird oft in einem Atemzug mit Jules Verne, H. G. Wells, Isaac Asimov und Arthur C. Clarke genannt. Viele halten ihn für den größten amerikanischen Science-Fiction-Autor des 20. Jahrhunderts. Allerdings hatte Heinlein auch seit jeher polarisiert wie kein Zweiter seiner Zunft. Mit Sternenkrieger schrieb Heinlein einen der umstrittensten Romane des Genres, und noch heute, Jahrzehnte nach seinem Erscheinen, löst dieses Buch unversöhnliche Grabenkämpfe aus. Paul Verhoevens Verfilmung Starship Troopers (1997) hat dafür gesorgt, dass der Roman in den letzten Jahren wieder vermehrt gelesen und leidenschaftlich diskutiert wurde. Die Kritiker werfen dem Werk vor, dass es eine militaristische, die Gewalt vergötzende Morallehre propagiere; nicht wenige haben dem Roman deshalb eine faschistoide Tendenz bescheinigt. Ihnen gegenüber steht eine vor allem in den USA beachtlich große Heinlein-Fangemeinde, die den Roman mit Entschiedenheit verteidigt.
Ich selbst habe den Roman vor fast 30 Jahren das erste Mal gelesen. Damals wie heute erging es mir bei der Lektüre gleich. Auch bei wohlwollendster und vorurteilsfreier Einstellung gelingt es mir nicht, das Buch in positivem Licht zu sehen. Es ist in der Tat ein stumpfsinniges, menschenverachtendes Machwerk, das gleich in mehrfacher Hinsicht nur schwer zu ertragen ist. Ich will im Folgenden dieses Urteil detailliert begründen und dabei die verschiedenen Gegenargumente aufgreifen, die die Verteidiger des Romans vorgebracht haben.
Sternenkrieger – eine unterhaltsame Space Opera?
Es gibt Leser, die Sternenkrieger lediglich als gekonnt geschriebenen, spannenden Unterhaltungsroman sehen. Oder Leser, die von Heinleins Romanen und Kurzgeschichten allgemein begeistert sind und mehr oder weniger deshalb Sternenkrieger mit milder Nachsicht beurteilen. In beiden Fällen geht es um das oberflächliche Lesevergnügen, um Heinleins Stil, um treffend geschilderte Figuren und eine interessante, spannende Handlung.
Die Erzählung als solche ist in der Tat recht kurzweilig, und die Figuren sind meistenteils nachvollziehbar. Eine Ausnahme bildet Johnnys Vater, dessen später, begeisterter Eintritt in die Armee mit Mitte vierzig (!) vollkommen kindisch ist (S. 194: „Ich musste mir selbst beweisen, dass ich ein Mann war. Nicht nur ein erzeugendes, verbrauchendes, ökonomisches Lebewesen . . . sondern ein Mann“). Auch die Mobile Infanterie wird glaubwürdig geschildert, trotz ihrer übertriebenen internen Brutalität. Wer je selbst einmal in einer Armee gedient hat, kann bestätigen, wie treffend Heinlein zahlreiche Abläufe und Zustände in der Armee darstellt – z. B. dass die Rekruten ständig danach trachten, ihr notorisches Defizit an Schlaf und Essen auszugleichen oder dass sie vielfach das schikanöse Verhalten der Vorgesetzten erdulden müssen. Heinlein war selbst neun Jahre lang Berufssoldat in der US-Marine gewesen, bis 1934 eine Tuberkulose-Erkrankung seine militärische Laufbahn beendete. In einem Kampfeinsatz war Heinlein allerdings nie gewesen.
Der sprachliche Stil Heinleins ist mir zu karg – es gibt kaum ausmalende Schilderungen, weder von Personen noch von Realia, etwa von Raumschiffen, Waffen, Ortschaften oder anderen Dingen; auch über die Bugs erfährt man praktisch nichts. Ein wenig konkreter hätte Heinlein seine Zukunft schon ausmalen können. Besonders stark wird der Lesefluss durch die immer wieder eingeschobenen „moralphilosophischen“ Exkurse unterbrochen, in denen Heinlein die Werte der terranisch-föderalen Gesellschaft erörtert. Der Schluss des Buches hinwiederum, der den Kampfeinsatz auf Planet P schildert, langweilt über viele Seiten mit pingelig genauen Erörterungen über die Einteilung und Vorgehensweise der verschiedenen Einsatzgruppen – das liest sich dann wie ein strategischer Schlachtplan, aber nicht mehr wie ein Roman.
Man kann das Buch somit durchaus allein nach dem oberflächlichen Unterhaltungswert beurteilen und dabei die Verfassung, die Heinlein für seine Gesellschaft der Zukunft entwirft, ignorieren. Heinlein allerdings zu bescheinigen, er habe seine gesellschaftliche Utopie nicht ernst gemeint – in welcher Hinsicht auch immer –, ist meines Erachtens unmöglich. Dafür hält Heinlein dem Leser zu penetrant die ständigen Moralurteile seines Personals vor Augen. Mehrfach wird die Moraldoktrin der Terranischen Föderation in Juan Ricos Unterricht zu „Geschichte und Moralphilosophie“ ausführlich doziert; auch nimmt Juan ständig bejahenden Bezug auf die Lehren dieser Unterrichtsstunden oder kommentiert auch sonst sämtliche Geschehnisse und Entscheidungen mit moralischen Urteilen. Es stellt sich also unweigerlich die Frage, was Heinlein mit seinen moralisierenden Exkursen und Kommentaren dem Leser vermitteln wollte. Entsprechen sie seiner eigenen Meinung, wollte er sie gar offensiv propagieren? Oder bildet Heinlein im Gegenteil das mahnende Schreckbild einer nicht erstrebenswerten, totalitären Zukunft, eine Anti-Utopie ab?
Die Veteranenrepublik
Der Kern der im Roman ausführlich erläuterten Ideologie, die der Verfassung der Terranischen Föderation zugrundeliegt, ist, dass der Einzelne sich erst ein moralisches Recht erwerben muss, an den politischen Geschicken der Gemeinschaft – dem Staat – teilhaben zu dürfen. Nur wenn er einen mindestens zweijährigen Militärdienst absolviert hat, wird ihm das passive und aktive Wahlrecht zugestanden. Der Militärdienst ist freiwillig, niemand wird gezwungen, ihn zu absolvieren. Wer den militärischen Drill physisch oder psychisch nicht durchhält, wird, wenn er nicht gleich von selbst den Dienst quittiert, auf harmlosere Dienstposten innerhalb der Armee bis hin zu einfachsten Arbeitsdiensten abgeschoben. Diese Posten gelten jedoch als minderwertig – wer auf ihnen landet, gilt innerhalb der Armee als Versager. Der ungediente Zivilist ist gemäß der Verfassung moralisch unwert, die Geschicke der Gemeinschaft mitzubestimmen. Indem er den Militärdienst nicht antritt, signalisiere er – angeblich –, dass er für die Gemeinschaft kein Opfer zu bringen bereit sei. Dieses Opfer schließt das eigene Leben nicht nur mit ein, sondern das eigene Leben ist ausdrücklich der Kern der Sache. Die Bereitschaft zu Sterben ist zwar nicht Teil des Eides, den alle Rekruten leisten müssen (S. 41f.), wird jedoch im ideologischen Unterricht mehrfach als das wesentliche Merkmal benannt, mit dem sich der Soldat moralisch gegenüber dem Zivilisten auszeichnet (S. 33 unten; S. 135 oben; S. 209 Mitte; S. 210f.).
Weshalb wird die Bereitschaft zu sterben so stark betont? Weil die darwinistische Moraltheorie des Romans voraussetzt, dass der in der biologischen Natur überall zu beobachtende Kampf ums Überleben auch der Urgrund und eigentliche Kern des menschlichen Seins sei. Alle Moralität leitet sich dieser Theorie zufolge vom Überlebensinstinkt ab. Auch der Mensch ist per se zunächst einmal nichts als ein Tier, das für die Sicherung des eigenen Überlebens jedes Recht auf Gewalttätigkeit auf seiner Seite hat. Die höchsten Überlebenschancen aber hatte der Mensch seit jeher in sozial organisierten Gruppen erfahren. Indem ein Individuum seinen egoistischen Lebenswillen dem Schutz der Familie, der Sippe oder dem Volk unterordnet – eben bereit ist, für die Gemeinschaft zu sterben –, sichert er das Fortbestehen jener Gemeinschaft und macht sie damit im ewigen Überlebenskampf erfolgreich. Mithin ist der lebensgefährliche Kampf zum Schutze der Gemeinschaft die höchste moralische Leistung, die der Mensch aus freien Stücken zu erbringen vermag. Die Lehre erhebt ausdrücklichen Anspruch auf universelle Geltung, und ein Wandel ist nicht in Sicht: Trotz der erfolgreichen Überwindung aller inneren Konflikte in der menschlichen Gesellschaft – in der Terranischen Föderation sind Revolutionen und Aufstände gegen das System praktisch unmöglich geworden (S. 209) – gilt die altruistische Überlebensmoralität weiterhin, denn das Weltall ist nicht weniger gefährlich als die Erde. Die außerirdischen Bugs machen dem Menschen die Planeten streitig, die der Mensch für seine Ausbreitung braucht, sie drohen den Menschen zu verdrängen und auszurotten, und so muss also weiterhin für die Gesellschaft gestorben werden.
Da nur „Gediente“, also „Veteranen“, das politische Mitwirkungsrecht erhalten, rekrutiert sich die politische Führungskaste in Sternenkrieger ausschließlich aus ihrem Zirkel. Die Entstehung dieser Gesellschaftsverfassung wird im Geschichtsunterricht erläutert (S. 128; 201–204). Am Ende des 20. Jahrhunderts war die alte Weltordnung in einem großen Krieg einer Allianz der USA, Russland und England gegen China untergegangen. Im anarchischen Chaos nach dem Zusammenbruch waren Veteranenverbände der Frontsoldaten die einzige ordnungsstiftende Macht, die für den Staat zu kämpfen und zu sterben bereit war. Die Veteranen nutzten diese Chance, griffen gegen die Anarchisten hart durch und rissen die Macht an sich. Anschließend errichteten eine neue Weltordnung, deren Grundfeste die strenge Moralität der „Truppe“ sein sollte.
Der Soldat – der bessere Mensch? Es liegt auf der Hand, dass die Konstitution der Terranischen Föderation unvereinbar mit unserem modernen Verständnis einer demokratischen Zivilgesellschaft ist. In einer wirklich demokratischen Gesellschaft haben alle ihre Mitglieder an der politischen Gewalt in Form des Wahlrechts teil – sie müssen sich nicht erst durch einen menschenverachtenden Militärdrill und die persönlich erklärte Bereitschaft, im Zweifelsfall auch für den Staat zu sterben, „moralisch“ ausweisen. Es genügt, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Deren politische Institutionen greifen mannigfach in das Leben eines jeden Individuums ein – schon allein daraus ergibt sich nach demokratischem Verständnis ein Recht auf Mitsprache. Beschränkungen gibt es lediglich in Hinblick auf das Alter (Kinder und Jugendliche dürfen noch nicht wählen; diese gut zu begründende Beschränkung spielt keine Rolle, da jeder einzelne zwangsläufig die gesetzte Altersgrenze überschreiten wird, es somit keine Benachteiligung einzelner Gruppen gibt) und auf die staatsbürgerliche Zugehörigkeit (wo in der Tat vielleicht nicht immer alles korrekt geregelt ist, da der Erwerb der Staatsbürgerschaft für Ausländer meist mit hohen Hürden verbunden ist – das ist hier aber nicht der Kern der Sache). Das moderne Demokratieverständnis stellt das Individuum, dessen persönliche Freiheit und Entwicklungsmöglichkeit in den Mittelpunkt. Der Staat ist zwar eine solidarische Gemeinschaft aller, die nicht ohne ein gewisses Maß an Pflichtbewusstsein dieser Gemeinschaft gegenüber bestehen kann. Die Freiheit des Einzelnen ist und bleibt jedoch der Dreh- und Angelpunkt der Verfassung.
In Heinleins Terranischer Föderation steht hingegen der Staat im Mittelpunkt, ihm hat sich das Individuum unterzuordnen. Die Freiheit des Einzelnen ist zwar gewährt, aber nicht unbeschränkt (auch wenn Juan Ricos Morallehrer anderes behaupten). Sobald „Ungediente“ danach streben, Missstände der Gesellschaft zu verändern, ist ihnen die politische Mitsprache verwehrt – ein massiver Zustand der Unfreiheit. Zu dienen aber heißt, sich der militärischen Hierarchie von unbedingtem Befehl und Gehorsam, physischer Brutalität und psychischer Demütigung zu unterwerfen und eine autoritär vermittelte Moraldoktrin widerspruchslos zu azkeptieren, die immerhin als „exakte Wissenschaft“ (!) verkauft wird und damit gegen Zweifel und Einwände abgedichtet worden ist. Auch dies hat mit Freiheit nichts zu tun.
Tatsächlich stellt sich die Ideologie von Sternenkrieger als ein kriegsverherrlichendes Gebilde dar, das vor allem dem Machterhalt einer militärischen Elite zweckdienlich ist. Es verklärt den Heldentod als die höchste moralische Leistung, zu der ein Mensch fähig ist, und zwingt militärische Ideale – Gehorsam und Aufopferung – der gesamten Gesellschaft als staatsbürgerliche Tugenden auf. Die Idee eines ewigen Überlebenskampfes, den angeblich auch eine weltweit vereinte Menschheit noch immer durchzufechten habe, entlarvt sich als zutiefst imperialistisch: Sie gründet auf der Unterstellung, dass dem Menschen ein ewiger Drang nach Ausbreitung in neue Territorien biologisch eingeschrieben sei. Die so gerechtfertigte Expansion aber liefert genau jene Kriege, derer eine militärische Führung bedarf, um ihren eigenen Führungsanspruch auch praktisch zu legitimieren. Nichts anderes bildet Sternenkrieger denn auch ab: Der Roman erzählt von den Kriegen, die die Menschen fern der Heimat auf Bug-Planeten ausfechten, um jene Welten dem eigenen Machtbereich einzuverleiben.
Manch Verteidiger Heinleins sieht im Gesellschaftsmodell des Romans allen Ernstes eine attraktive Alternative zu unserer angeblich so politikverdrossenen und egozentrischen „Spaßgesellschaft“. Die Betonung der Pflicht und Verantwortung des Bürgers gegenüber der Gemeinschaft werden dabei als besonders attraktiv herausgestellt, und gern wird in diesem Zusammenhang an John F. Kennedys berühmten Satz erinnert: „Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country“. Nun, für meine Begriffe wird Heinleins Utopie auch mit dem Verweis auf JFK nicht besser. In einem autoritären Staatsgefüge, das von martialischem Wortgeklingel erfüllt ist, würde ich keinesfalls leben wollen.
Der Militarismus
Eine verpflichtende Ideologie, in der der Kodex des Soldaten zum Maß aller Dinge gemacht wird, und eine politische Kaste, zu der nur militärisch gedrilltes Personal gehört – unter solchen Vorzeichen muss die Gesellschaft militaristisch geprägt sein. In Sternenkrieger zeigt sich die Vergötzung des Militärs und gleichzeitige Geringschätzung von allem Zivilen auf Schritt und Tritt. Ein Mann ist dort erst ein Mann, wenn er gedient hat. Innerhalb der Armee gelten rüde Umgangsformen und wird ein rauer, pathologischer Männlichkeitskult gepflegt. So werden beispielsweise Kompetenzstreitigkeiten im institutionalisierten Faustkampf im Waschraum entschieden; der Sieger ist fortan das Alphatier (S. 169f.). Härte und Unbeugsamkeit, sowohl im Einstecken wie im Austeilen, sind unabdingbar, um im Wolfsrudel zu bestehen – so gerinnen „Tugenden“, weit über die Armee hinaus. Wer die erforderliche Abhärtung durchsteht, ohne zu zerbrechen, darf sich dazugehörig fühlen – und entwickelt voller „Stolz“ den entsprechenden „Chorpsgeist“ (S. 237). Im Fronturlaub sind Schlägereien und Bordellbesuche an der Tagesordnung (S. 179f.). Die Form der Geselligkeit, in der die künftigen wahlberechtigten Staatsbürger sozialisiert werden, ist der „Herrenabend“ (S. 158). Es ist nur schwer vorstellbar, dass der vom Soldaten verinnerlichte chauvinistische Habitus auf sein künftiges Leben als Vollbürger keinen Einfluss haben soll. Vielmehr scheinen Heinleins Figuren im Roman genau dieses Gebaren für die eigentlich erstrebenswerte Form des Soziallebens zu halten. Sein Ich-Erzähler und im Prinzip auch alle anderen Figuren des Romans identifizieren sich jedenfalls völlig mit der soldatischen und gesellschaftlichen Ordnung. Wo diese kritisch reflektiert wird, wird der Widerstreit stets „moralphilosophisch“ und „wissenschaftlich exakt“ zugunsten der herrschenden Ordnung entschieden.
Es gibt nur zwei Menschen in dem Roman, die dem Zivilen gegenüber dem Militärischen den Vorzug geben und damit ein kritisches Moment in Heinleins Roman einbringen könnten. Zum einen ist es der Vater, der das Wahlrecht nicht erstrebt und es für klug hält, sich aus der Politik herauszuhalten. Sein Standpunkt wird später als falsches und feiges Zögern hingestellt, denn der Vater tritt gegen Ende des Romans schließlich selbst mit Begeisterung der Armee bei. Zum anderen ist es der Arzt, der Rico bei der Musterung untersucht. Der Arzt ist Zivilangestellter, und seiner Ansicht nach ist der Militärdienst etwas „für Ameisen“; er blickt kopfschüttelnd auf das, „was man ihnen (den Rekruten) angetan hat“ (S. 40). Wie Ricos Vater geringschätzt er das Wahlrecht, scheint aber wie dieser in erster Linie wegen der persönlichen Bequemlichkeit den Dienst nicht antreten zu wollen – er will sich eben selbst nichts „antun lassen“. Die kritische Meinung des Arztes füllt gerade einmal einen Absatz; später wird auf sie nirgendwo mehr Bezug genommen.
Hängt ihn höher . . .
Härte regiert, Härte siegt – diesem sozialdarwinistischen Lehrsatz folgen auch die kruden Prinzipien zur Erziehung und Strafverfolgung, die ebenfalls Teil des „moralphilosophischen Unterrichts“ und damit der ideologischen Schulung der Terranischen Föderation sind. Triebtäter sind in der schönen neuen Welt von Sternenkrieger zwar durchaus krank, aber nicht heilbar und daher unwert, weiter zu leben. Sie werden mit tollwütigen Hunden verglichen (S. 127) und müssen wie diese zum Wohle der Allgemeinheit beseitigt werden – indem man ihnen einen gnadenvollen Tod durch den Strang zukommen lässt. Jugendliche Straftäter müssen erzogen werden wie „junge Hunde“ (S. 128) – das gelingt nach der Ansicht der Morallehre in Sternenkrieger nur mit harter Hand, d. h. mit Auspeitschungen. Pflichtbewusstsein muss mit der „Zuchtrute“ (S. 135) eingeprügelt werden.
Bedarf es hier wirklich noch eines Kommentars? Was als „wissenschaftlich exakte“ Pädagogik der Welt von übermorgen geschildert wird, ist in Wirklichkeit die Amok laufende Perversion verstaubter Rohrstock-Erziehung. Die Erziehungsmaximen, die der Roman schildert, passen sich nahtlos ein in die soldatische und gewaltverherrlichende Ideologie, die in der Terranischen Föderation herrscht. Und sie werden genauso wie diese Ideologie nirgends in Frage gestellt.
Alles nicht so gemeint?
Heinlein-Fans behaupten bisweilen, ihr Idol hätte sich die im Roman geschilderte Sozialutopie gar nicht zu eigen gemacht, sie sei von ihm eigentlich als Menetekel, als mahnende Anti-Utopie gedacht. Das ist zweifelsfrei auszuschließen. Zum einen findet sich, worauf bereits hingewiesen wurde, nirgends im Roman eine nennenswerte Relativierung oder kritische Brechung der Utopie. Der Roman ist zwar in Ich-Form und demgemäß aus der Perspektive eines überzeugten Soldaten und Anhängers der herrschenden Ideologie geschrieben. Dennoch begegnet der Ich-Erzähler, Juan Rico, nirgends einem stärkeren kritischen Widerstand (in Form von widersprechenden, anders lebenden Personen, in Form von Texten oder Geschichten oder in Form sich anmeldender Zweifel usw.), an dem sich die Ideologie reiben oder gar ernstlich aufreiben würde. Alle aufkommenden Widersprüche oder Zweifel werden stets von der terranisch-föderalen Ideologie problemlos bewältigt und lösen sich vollständig auf. Die militaristische Haltung, die das gesamte Werk durchzieht, wird zudem auch durch die markigen Aphorismen verschiedener historischer Generäle und Heerführer unterstrichen, die den einzelnen Kapiteln jeweils vorangestellt werden. Sie sollen die Moraldoktrin des Buches offenbar illustrieren und mit historischen Beispielen unterstreichen. Diese aus der Ich-Perspektive herausfallenden Kommentare gipfeln in der patriotischen Ehrung des im Zweiten Weltkriegs gefallenen Gefreiten Rodger W. Young ganz am Ende des Buches; sein Schicksal muss als Musterbeispiel eines vorbildlichen, aufopfernden Soldaten herhalten, der für seine Kameraden den Heldentod gestorben ist.
Zum anderen hat Robert A. Heinlein selbst den Roman nie als Anti-Utopie interpretiert. Es ist bekannt, dass Heinlein Sternenkrieger als Reaktion auf eine politische Entscheidung der Eisenhower-Regierung geschrieben hat, die ihn rasend wütend gemacht hatte. Präsident Eisenhower hatte 1958 erklärt, einseitig auf Atombombentests zu verzichten, in der Hoffnung, dass die Sowjetunion diesem Beispiel folgen würde. Als die Sowjets ungerührt mit ihren eigenen Tests fortfuhren, legte Heinlein Eisenhowers Politik als schändliche Schwäche dem Feind gegenüber aus. Er unterbrach seine Arbeit an einem anderen Roman und verfasste in wenigen Wochen Sternenkrieger. Vor diesem Hintergrund muss der Roman zwangsläufig als literarische Kampfschrift aufgefasst werden. Militärische Stärke ist das Credo des Werkes, mit Sicherheit nicht deren kritische Reflexion.
Heinlein hat noch Jahrzehnte später versucht, sich gegen die nicht abreißende Kritik zu verteidigen – so vor allem im 1980 erschienenen Kompendium Expanded Universe. So sagte Heinlein zwar, dass „seine Figuren für sich sprächen“, sodass nicht alles, was diese äußern, auch seine eigenen Ansichten sein müssten – eine literarische Binsenweisheit. Aber er behauptete auch, dass der “Federal Service”, den ein Mensch in Sternenkrieger für das Wahlrecht ableisten muss, in erster Linie ein “Federal Civil (!) Service”, d. h. ein ziviler Dienst an der Gesellschaft sei; nur ein ganz geringer Prozentsatz der Dienstleistenden seien tatsächlich Soldaten. Diese Behauptung, die den “Federal Service” umzudeuten und abzumildern versucht, impliziert, dass Heinlein die von ihm ersonnene Institution des “Federal Service” im Prinzip gutheißt – sie ist vom Autor nicht als anti-utopisches Zerrbild, sondern tatsächlich utopisch im positiven Sinne gedacht.
Dessen ungeachtet hat James Gifford in seiner hervorragend recherchierten und scharfsichtigen Abhandlung The Nature of “Federal Service” in Robert A. Heinlein’s Starship Troopers (1996) zeigen können, dass Heinlein mit seiner Umdeutung des “Federal Service” in einen “Federal Civil Service” schlichtweg falsch liegt – der Wortlaut seines Romans straft diese These Lügen. Jeder, der sich in der Terranischen Föderation dienstverpflichtet, unterstellt sich dem Militär und gilt fortan als Soldat, selbst wenn er zum Kartoffelschälen auf ein Transportschiff oder als Zwangsarbeiter in eine Mondmine abkommandiert wird. Dieses Schicksal trifft alle, die dem harten Drill der Rekrutencamps nicht gewachsen sind, die aber trotzdem nicht den Dienst quittieren wollen. Die Armee sieht es indes lieber, wenn „minderwertige“ Rekruten den Dienst gleich ganz quittieren, und auch sonst setzt sie alles daran, die Rekruten so gründlich zu sieben, bis nur noch ein kleiner Bruchteil für die kämpfenden Truppen übrig bleibt. Die, die aufgeben, werden als Versager angesehen und auf minderwertige Dienstposten „abgeschoben“. Die Soldaten der kämpfenden Einheiten dagegen lassen keinen Zweifel daran, dass sie sich selbst als die moralische Elite der Menschheit ansehen.
Diese Elite ist das Resultat einer gnadenlosen und fortwährenden Auslese. Jederzeit, sogar noch während der Offiziersausbildung, kann es dem Soldaten passieren, dass er als moralisch unwürdig erachtet und ganz aus dem Dienst ausgestoßen wird (S. 200). Dass Heinlein in seinem Roman militärische Ersatzposten für jene geschaffen hat, die den Drill der Kampfeinheiten nicht durchstehen, wirkt vor dem Hintergrund seiner sich elitär zuspitzenden soldatischen Gesellschaft nur wie eine unliebsame Reparatur des Systems. Die vielen, die den hehren Anspruch, möglicherweise für die Gesellschaft zu sterben, nicht erfüllen, sollten nicht einfach ausgeschlossen werden. Der Ersatzdienst ist für Heinleins Ausleseverfahren eine Notwendigkeit und für den Roman ein demokratisches Feigenblatt, aber gleichwohl ein Ärgernis, denn er verwässert die reine Lehre vom süßen Heldentod für die Gemeinschaft. Auch an anderer Stelle wird dieser Widerspruch deutlich: So erwähnt Ricos Morallehrer einmal, dass die Kriminalitätsrate unter den Veteranen genauso hoch sei wie unter Ungedienten – was die fürwitzige Frage zulässt, inwiefern der freiwillige Militärdienst den Menschen tatsächlich als moralisch höherwertig ausweist.
Eine andere Reparatur des Systems in Sternenkrieger betrifft die Einordnung der Frauen. Auch Frauen haben das Recht, sich beim Militär zu verpflichten. Heinlein räumt ihnen großzügig die Rolle der Raumschiff-Pilotinnen ein, für die sie angeblich physiologisch besser geeignet seien – und schließt sie gleichzeitig mit demselben geschlechtsspezifischen Chauvinismus bei den kämpfenden Truppen aus: Frauen seien angeblich nicht in der Lage, den eisenharten Drill der Mobilen Infanterie durchzustehen. Es gibt in der Mobilen Infanterie folglich keine Frauen. Immerhin lässt Heinlein die Frauen am Militärdienst und an der politischen Gewalt teilhaben, statt sie nur in das Ehebett und in die Küche zu schicken. Damit ist er anno 1959 fortschrittlicher als manch anderer SF-Autor jener Zeit. Aber die Frauen sind offensichtlich gar nicht Heinleins Thema. Seine Faszination gilt ganz dem durch und durch männlichen, raubeinigen Soldatenleben.
Streitbare Verteidiger des Romans wie Christopher Weuve sehen in dem Umstand, dass die meisten Dienstverpflichteten tatsächlich eher nichtmilitärische Posten bekleiden und am Ende ihrer Dienstzeit dennoch ihre Vollbürgerschaft und ihre Wahlrechte erhalten, ein Argument gegen den Militarismusvorwurf. Sie behaupten sogar, der Roman sei gar kein Buch über das Militär, sondern über „bürgerliche Tugenden“, über den Zusammenhang von Rechten und Verpflichtungen und der Moral „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“. Das Militär sei nur das Vehikel, mit dem sich diese Tugenden besonders gut illustrieren ließen: “The details of the Mobile Infantry are not the point that Heinlein was trying to make; they are means to an end, not the end itself” (Christopher Weuve, Thoughts on Starship Troopers vom 4. Juli 2009).
Angesichts der minutiösen Darstellung des Lebens in der Mobilen Infanterie, der Begeisterung, mit der es geschildert und vom Ich-Erzähler bejaht wird, und der verächtlichen Haltung den nicht kämpfenden Dienstverpflichteten und allen Zivilisten gegenüber, muss die Deutung Weuves zumindest als kühn bezeichnet werden. Ich halte sie für schlichtweg falsch. Es stimmt, dass Heinlein das Militär nicht allein um seiner selbst willen schildert. Zur Darstellung sollen aber nicht etwa „bürgerliche Tugenden“ kommen – sondern soldatische Tugenden, die zu allgemeingültigen bürgerlichen Tugenden erhoben werden sollen. Der Roman trägt sehr starke propagandistische Züge, die dieses Ziel verfolgen. Das hat ihn offenbar schon bei seinem Erscheinen für viele Leser ungoutierbar gemacht.
Ein Fazit
Sternenkrieger ist eine kaum erträgliche propagandistische Kampfschrift, die alles Militärische hemmungslos feiert und sich dazu versteigt, Ideale von Chorpsgeist, unbedingtem Gehorsam und Heldentod zu Tugenden der gesamten Gesellschaft zu adeln. Jeden, der diesen Tugenden nicht entspricht, diskriminiert Heinlein als Teil einer geringerwertigen Masse ohne Bürgerrechte, die von einer Veteranenelite regiert wird. Zudem hängt das Buch einem rohen und chauvinistischen Männlichkeitskult an und verlacht dreist unsere moderne demokratische Zivilgesellschaft als verweichlicht und unmännlich, indem sie ihr einen Zerrspiegel sozialdarwinistischer und moralphilosophischer Halb- und Unwahrheiten vorhält.
Gerade aus deutscher Perspektive erscheint Sternenkrieger besonders prekär. All das, was Heinlein als ideale Gesellschaft von morgen präsentiert, hat Deutschland längst durchlebt – im militaristischen Kaiserreich und später im Nationalsozialismus. Die moralischen Kategorien, die in diesen beiden Epochen der deutschen Geschichte Gültigkeit besaßen, sind häufig nicht sehr weit entfernt von dem, wofür sich Heinlein in Sternenkrieger begeistert. So nimmt es nicht Wunder, das viele Kritiker Heinlein als Faschisten beschimpft haben. Dieser Vorwurf schießt vielleicht über das Ziel hinaus, da Heinlein die Terranische Föderation immerhin nicht als diktatorisches Terrorregime darstellt. Eine faschistische Tendenz hat die Ideologie und die Gesellschaft seiner Utopie gleichwohl, sodass es vollauf berechtigt ist, sie faschistoid zu nennen.
Das wirklich Fatale an dem Buch ist, dass es auch heute noch auf viele Leser eine gewisse Attraktivität ausstrahlt. Viele sind offenbar der Auffassung, die Moraltheorie Heinleins sei ein dankenswerter Ansatz, über unsere Zivilgesellschaft nachzudenken, und gelangen zu dem Schluss, dass eine Art “Federal Service”, an den das Wahlrecht zwingend gekoppelt ist, unserer Gesellschaft gut zu Gesichte stehen würde. Dass mit der Umsetzung derartiger Ideen die Grundfesten unserer demokratischen Ordnung ausgehebelt würden, zu denen der Lehrsatz gehört, dass allen Mitgliedern der Gesellschaft politisches Mitspracherecht zusteht (ungeachtet der tatsächlichen Beschränkungen durch Alter und staatsbürgerlicher Zugehörigkeit), und dass überdies unsere Gesellschaft aus bitteren historischen Erfahrungen heraus ganz bewusst als Zivilgesellschaft konstituiert ist, kann nicht oft genug warnend betont werden.
© Michael Haul
Veröffentlicht auf Astron Alpha am 14. April 2016
