Arthur C. Clarke: Projekt: Morgenröte

The Sands of Mars (1951). Science-Fiction-Roman. In deutsch erstmals 1953 im Gebrüder Weiß Verlag (Berlin), seit 1963 in mehreren Auflagen im Wilhelm Goldmann Verlag (München) erschienen. Übersetzung ins Deutsche von Herbert Roch. Taschenbuch, 222 Seiten. Das Bild links zeigt das Cover der vorliegenden dritten Auflage vom Juni 1983 (29.–38. Tsd.)
Mitte der Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts hat die Menschheit bereits fantastische Schritte ins All unternommen: Bemannte Flüge mit Atomraumschiffen zum Mond, zur Venus und zum Mars sind alltäglich, und auf dem Mars existieren erste menschliche Siedlungen. Der bekannte Science-Fiction-Autor Martin Gibson wird zu Werbezwecken zu einem Flug zum Mars eingeladen, um sich zum ersten Mal in seinem Leben ein eigenes Bild von der Raumfahrt und dem roten Planeten zu machen. Er erlebt die faszinierende Welt der Raumfahrer und marsianischen Kolonisten. Zu Beginn seiner Reise stellt er sich zunächst ungeschickt an – so überwältigt ihn die „Raumkrankheit“, und er erbricht sich in das Cockpit der Shuttlerakete, die ihn zur erdorbitalen Raumstation bringt. Die Astronauten, mit denen er die nächsten drei Monate an Bord des Raumschiffes Ares auf dem Weg zum Mars verbringt, belächeln anfangs Gibsons Unerfahrenheit. Mit der Zeit gelingt es dem lernfähigen Gibson jedoch, die Freundschaft seiner Schiffsgenossen zu gewinnen.
Endlich auf dem Mars eingetroffen, ist Gibson fasziniert von der Tatkraft und dem zähen Durchhaltewillen der wenigen tausend Kolonisten, die unter mächtigen aufblasbaren Kuppeln ihre ersten bescheidenen Siedlungen gegründet haben, den Mars und seine karge Biosphäre erforschen und sich darum bemühen, von den Versorgungsgütern der Erde unabhängig zu werden. Er erkennt die Sinnhaftigkeit dieser Pionierleistungen und stellt sich die Frage, ob er selbst nicht daran teilhaben könnte . . .
Der Mars ruft . . .
Der englische Schriftsteller Arthur Charles Clarke (1917–2008) gehört zu den bedeutensten Science-Fiction-Autoren aller Zeiten und wird häufig in einem Atemzug mit Namen wie Jules Vernes, Herbert George Wells oder Isaac Asimov genannt. Wie jene war Clarke ein Vertreter der technisch orientierten Science-Fiction und prägte das Genre in der Nachkriegsära entscheidend mit. Weltruhm erlangte er vor allem durch seine literarische Vorlage für Stanley-Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum (1968), einem der wichtigsten Meilensteine des Science-Fiction-Kinos. Außerordentliche Leistungen im Genre konnte Clarke allerdings schon viele Jahre vor 2001 vorweisen. Bereits seit 1951 hatte Clarke Science-Fiction veröffentlicht. Im jenem Jahr erschien auch Projekt: Morgenröte, sein dritter Roman, und schon in diesem frühen Werk zeigt sich Clarkes schriftstellerisches Können.
Der Zauber erschließt sich nicht sofort. Clarke pflegt einen sehr ruhigen, abgeklärten Stil, und auf so manchen heutigen Science-Fiction-Leser, der rasante Action und nervenzerrende Spannungsbögen gewohnt ist, dürfte der Roman erst einmal recht behäbig bis langweilig wirken. Lässt man sich aber auf das milde Temperament der Erzählung ein, wird man mit einem gekonnt geschriebenen, nostalgischen Science-Fiction-Abenteuer belohnt, das die Einstellungen und Erwartungen der Fünfzigerjahre wieder lebendig werden lässt – einer Zeit, in der noch alles möglich schien, eine naive Fortschrittsgläubigkeit herrschte und die Menschen noch fest von ihrer glänzenden, gar nicht allzu fernen Zukunft im Weltall überzeugt waren.
Der Kontrast zur minderwertigeren Pulp-SF mit ihren schablonenhaften Figuren und ihrer mageren Sprache ist überdeutlich – stilistisch wie inhaltlich. Clarkes Astronauten sind keine markigen Wildwesthelden, keine raumfahrenden Raubeine – ein Science-Fiction-Klischee, über das sich Clarke dort, wo seine Figuren über die Werke des Science-Fiction-Autors Martin Gibson reden, mit trefflicher Ironie lustig macht. Der studierte Physiker und Mathematiker Clarke, der immer darum bemüht war, “Science-Fiction” im Wortsinne zu schaffen und seine Spekulationen strikt auf dem Tatsachenboden der Wissenschaften zu gründen, sieht mit klarem Blick, dass im Weltraum dereinst keine tollkühnen Haudegen, sondern nüchterne, erstklassig ausgebildete Spezialisten erforderlich sein werden. Ein solches Personal ist zunächst einmal unspektakulär und erfordert größere Anstrengungen, um mit ihm eine interessante Erzählung zu fabulieren. Um dieses Dilemma zu lösen, bedient sich auch Clarke einiger stereotypischer Kunstgriffe. So weiß er darum und schildert es auch, dass ein dreimonatiger Raumflug zum Mars vor allem eines sein wird: ereignislos und langweilig. Gleichwohl lässt Clarke der Erzählung halber einige dramatische Ereignisse geschehen. Einmal muss die Crew eine Rakete einfangen, die dem Schiff vom Mond aus hinterher geschickt wurde; einmal muss ein Leck in der Außenhülle abgedichtet werden, das ein Meteorit verursacht hat; einmal wird es Martin Gibson gestattet, in Begleitung einen Weltraumspaziergang zu unternehmen, der ihn weit weg vom Schiff führt, bis er nur noch rundherum von Sternen umgeben ist.
All dies wird unaufgeregt geschildert und dramatisch nicht überzeichnet. Clarke geht es vor allem um die Faszination Raumfahrt. Voller Poesie schildert er etwa Gibsons Eindrücke, wie er still und frei im All schwebt und sich mit den Sternen eins weiß (S. 59). Der Raumflug ist ein begeistertes Abenteuer voller Staunen – und eine Bekräftigung der Ideale des ewig neugierigen, weiter strebenden Menschen, der ins All aufbricht, um sich dort neue Lebensräume zu erschließen.
Beim Lesen drängt sich immer wieder ein Grundzug von Clarkes Erzählstil auf: seine schon oft beschworene menschliche Wärme. Clarkes Figuren sind durchweg sanfte, nachvollziehbare Menschen mit Ecken, Kanten und Schwächen. Zwar sind sie hier und da nicht ganz frei von Klischees, aber Clarke versteht es, sie mit einer menschlichen Tiefe zu zeichnen, die zur damaligen Zeit nur selten in der Science-Fiction anzutreffen war. Wie Martin Gibson beispielsweise mit seinem persönlichen Lebensweg hadert, mit seinen verpassten beruflichen Chancen und seinem latenten Minderwertigkeitskomplex, doch „nur“ ein Schriftsteller zu sein, der kaum den Respekt der tatkräftigen Raumfahrer, Ingenieure und Kolonisten verdient – das ist überzeugend und einfühlend geschildert. Auch die Innenansicht des „halbstarken“ Astronauten-Lehrlings Jimmy Spencer – eine Mischung aus peinlicher Unsicherheit und kühnem Zielstreben – ist menschlich nachvollziehbar.
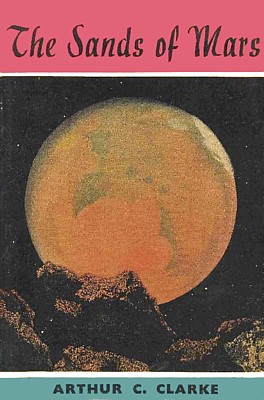
Natürlich springt dem Leser auch die antiquarische Last ins Auge, die der Roman zwangsläufig mit sich führt. Man fliegt zum Mars, benutzt jedoch noch Schreibmaschinen (S. 30) und Leica-Fotoapparate (S. 21), das Funkgerät arbeitet mit Röhren (S. 46), und auf der Erde ist noch immer das Schwarzweiß-Fernsehen aktuell (S. 206). Der Mars selbst wird viel zu milde dargestellt, mit Temperaturen weit über Null Grad, einer Atmosphäre, die ausreichend gegen kosmische Strahlung schirmt, mit spärlicher Marsvegetation und sogar mit Marstieren, die an Känguruhs erinnern. Und auch gesellschaftlich entspricht alles den Fünfzigerjahren: Frauen spielen keine Rolle, sie dürfen lediglich als Stenotypistinnen oder gebärfähige Ehefrauen auf den Mars. Die heldenhafte Pionierarbeit im All ist ausschließlich den tatkräftigen, forsch vorangehenden Männern vorbehalten. Das gutbürgerliche Gesellschaftsleben auf dem Mars besteht aus festlichen Empfängen beim Marsgouverneur in Abendgarderobe oder aus „Revuefilmen“ im einzigen Theater des Planeten. Doch jeder Roman, ob Science-Fiction oder nicht, ist immer ein Kind seiner Zeit, und so kann man all dies dem Werk nicht zum Vorwurf machen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie Clarke in der Figur des Science-Fiction-Autors Martin Gibson zugleich auch das Science-Fiction-Genre selbst reflektiert (S. 49–51). Zwischen Gibson und dem Kapitän der Ares, Norden, entspinnt sich eine Unterhaltung über den bleibenden Zeitwert von Science-Fiction-Literatur. Norden ist der Ansicht, dass Science-Fiction schon nach wenigen Jahren veraltet und dann unlesbar wird; Gibson verteidigt sein Metier mit den Klassikern Verne und Wells, die ja auch immer noch gelesen würden, obwohl sie überholt sind. Das Streitgespräch ist für den Leser vergnüglich: Er weiß, dass, indem er diesen Roman in Händen hält, Clarke selbst mit seinem Werk den Streit für Gibsons Standpunkt entschieden hat.
Ein anderes, sehr interessantes Streitgespräch findet zwischen Gibson und Warren Hadfield, dem Gouverneur des Mars statt (S. 92–94). Es geht um die sachliche und ideologische Begründung der Marskolonisation. Warum sollte die Menschheit sich überhaupt auf unwirtlichen Planeten ansiedeln, wenn doch die Kosten für dieses Unterfangen exorbitant sind? Damals wie heute stellt sich dieses Dilemma als die schwierigste Crux aller Science-Fiction-Autoren und ganz real aller Befürworter von bemannten Flügen zum Mars dar. Clarke blendet anders als viele seiner Kollegen diese Frage wenigstens nicht aus. Seine Argumente laufen aber auch bei ihm auf den Versuch hinaus, eine raumfahrtfreundliche Ideologie zu schaffen. Er zieht Vergleiche mit der Kolonisierung Amerikas heran, die anfänglich auch nicht wirtschaftlich zu rechtfertigen gewesen sei, er beschwört den Pioniergeist des Menschen („Wo Menschen leben können, wird auch eines Tages Heimat für irgendeinen sein“), und proklamiert zweckoptimistisch: „Die Erde braucht zwar den Mars noch nicht, aber eines Tages wird sie ihn brauchen.“
Ohne Technologie ist der Mensch im All undenkbar. Ihr widmet Clarke immer wieder längere Abschnitte, die beleuchten, wie genau die Raumfahrt funktioniert, wie der Aufbau der Marskolonien vonstatten geht und wie die Menschen auf dem Mars die vorgefundenen Möglichkeiten technisch für sich nutzen (z. B. die Sauerstoffgewinnung aus dem Eisenoxid des Marsbodens). Hier bemüht sich Clarke stets, auf der Grundlage der damals vorhandenen und denkbaren Technologie alles so „realistisch“ wie möglich zu gestalten. Vieles davon erscheint auch heute noch plausibel und seriös durchdacht. Clarke will dem Leser vor Augen stellen: Ja, es geht, wir können uns kraft unserer technischen Möglichkeiten auf dem Mars ansiedeln. Das ist die eigentliche Mission des Romans, über seine unterhaltende Funktion hinaus.
Selbstverständlich bejaht Clarkes raumfahrender Mensch die Technik, jegliche Technik, wenn sie ihn nur voranbringt. Diese Haltung mündet in eine heute recht befremdlich wirkende, damals nicht hinterfragte monströse Technokratie: Der Gouverneur der Marskolonien, ein Patriarch alter Schule, entscheidet ganz allein im Kreise seiner wissenschaftlichen Ratgeber, unter höchster Geheimhaltung und damit vollkommen undemokratisch, dass der Marsmond Phobos thermonuklear zu einer zweiten Sonne gemacht werden soll. Gerade die Anwesenheit von Marspflanzen und Marstieren, mehr noch die inzwischen längst bewiesene Unfähigkeit des Menschen, sein Handeln ökologisch abzuschätzen und zu kontrollieren, lässt dieses unerhörte Terraforming-Projekt höchst prekär erscheinen. In den fortschrittsgläubigen Fünfzigerjahren hatte sich vermutlich niemand an diesen Einwänden gerieben – eher dürfte die kühne Vision als grandiose Idee bestaunt worden sein.
So bietet Projekt: Morgenröte auch dem heutigen Leser noch recht ordentliche Kurzweil. Der Roman ist eine träumerische Abenteuerreise zum Mars, wunderbar nostalgisch, aber technologisch durchaus intelligent durchdacht. Es werden mehrere Fragen zur Raumfahrt beleuchtet, die sogar noch heute aktuell sind, und eine kühne, positive Perspektive aufgezeigt – die Botschaft einer Zeit, in der es keine Grenzen zu geben schien. Ja, so hätte es sein können – und es schmerzt fast ein wenig, dass alles nicht so gekommen ist. Ein empfehlenswerter Klassiker.
© Michael Haul; veröffenticht auf Astron Alpha am 23. August 2016
